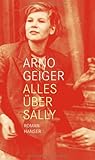1.
Die gängige Spur, diesen Roman von Florjan Lipus als Dokument der slowenischen Volksgruppe zu lesen, die Peter Handke mit seiner Übersetzung ins Deutsche gelegt hat, wird bestehen bleiben und kann von jedem betreten werden. Es führen aber noch viele andere Spuren zu und durch dieses Werk, und besonders um derentwillen, die das Werk jenseits wieder verlassen, soll noch ein anderer Durchgang versucht werden.
a.
Endlich gehst du durchs Dorf, beginnt Buch und Erzählung, also mit einer Rede, die im ganzen Roman anhält und ein Du hat, aber keineswegs den Leser. Vom Ende her gesehen könnte das eine Art Biograph sein, einer, der die Geschichte des Zöglings aufschreibt, aber jedenfalls erzählt er sie ihm, erzählt ihm also die eigene Geschichte. Warum tut man das? Es ist wie das gemeinsame Betrachten alter Familienfotos, da wird gezeigt und identifiziert, und mitunter neu gedeutet. Dem Zögling wird vom Ende her seine eigene Geschichte gesagt, er ist verwirrt, ihm wird gesagt: schau her, das bist du, so bist du.
b.
Das Dorf, durch das Tjaz zur Bahnstation geht:
das zwischen deiner Bahnstation und dem Elternhaus liegt, und das heißt nicht viel: es ist ihm gewährt, dazwischenzuliegen, mag es dir auch im Weg sein auf dem Weg zur Station. (S.5 – zitiert nach der Ausgabe Suhrkamp 1984)
Ist das eine Überhebung des Zöglings, dass dem Dorf die Gnade seiner Beheimatung zukommt? In der Anrede mag es eine Beschwörung sein, die ihn groß macht und ihm eine Identität verleiht, die
vor dem Dorf und seiner restlichen Umgebung liegt. Aber recht allgemein soll diese Verortung des Zöglings zunächst nur
Subjektumkehr genannt werden: nicht der Gehende durchkreuzt die Umgebung, sondern die Umgebung umlagert den Gehenden. Auf dem Lebensweg des Zöglings liegen: Elternhaus, Dorf, Bahnstation.... So funktioniert der Text.
c.
So sitzt du eigentlich nicht im Zug, obwohl du inzwischen schon eingestiegen bist, sondern treibst dich in den Mäulern deiner Dörfler herum und bist ihnen Anlaß zu Gedampfe. Obwohl sie nicht die Deinen sind und du keiner von ihnen bist, sind sie doch die Deinen, und du bist einer von ihnen, weil sie dich zu ihresgleichen gezählt haben, sie selbst haben ja sonst niemanden, du hast dich ihrer erbarmt (8). Zur Subjektumkehr, die nun deutlich als Gnade dargestellt ist, tritt noch eine Dislokation: Gesprächsstoff sein mindert die Präsenz im fahrenden Zug. Gesprächsstoff sein ist eine Aktivität, vergleichbar der wiederkäuenden Verdauung von Kühen. Und noch eine weitere Art von Subjektumkehr läßt es pendeln, wer nun zu wem gehört, wer also der Aktive und wer der Zugehörige ist. Zuletzt bleibt die Unzugehörigkeit: die niemand haben, sind die Heimatlosen (ich will nicht von der Volksgruppe reden!) – d.h. in der Rückgängigmachung der Subjektumkehr wird nun deutlich der Tjaz als der Heimatlose, Unzugehörige, ja Verlorene sichtbar, und in der Rede wird ihm gerade das Gegenteil beschworen. Das zum Sinn dieser Redeform.
d.
Ist es Gottes Wille gewesen, ist es nicht Gottes Wille gewesen, Tjaz hat angefangen, sie von unten her anzuschauen, statt von oben, dabei ist er sich auch seiner Verwirrung bewußt geworden. Der Internatling schaut das Weib grundsätzlich von oben an (16). Zur Subjektumkehr tritt der Perspektivenwechsel. Das Internat liegt am Berghang und schaut ins Tal. Der Zögling wird einmal ein gebildeter Mensch, und schaut auf die Dorfbewohner herab. Das geistliche Institut bereitet auf ein geistliches Leben vor und blickt daher auf die Frau herab. Nun, das sind alles die Trampelpfade biederen Lesens. Aber hier ist von Gottes Blick die Rede. Und der Wechsel in die irdische Perspektive ist derjenige der Versuchung:
aber wenn ihn die Augen verleiten. Wenn hier aber Adam und Eva mitzulesen sind, dann wird die Frage nach Gottes Willen zur theologischen Frage: Will Gott die Versuchung? Das Verleitetwerden durch die Augen klingt wie Ausrede, bei Adam: die Schlange – aber ist nicht beides gleichermaßen Subjektumkehr? Dann ist der ganze Text als Rechtfertigung zu lesen.
e.
Die Initiation, die nun folgt, wird als Vorgang zwischen Erde und Mensch erzählt:
Beute – Finger – Stengelchen – Widerstand – stinkigen Saft, Finger bespritzt – Säfte versagt – strotzende Lebensverlangen – heilsamen Berührungen – ranzigen Ausdünstungen – Blut aus der Wunde gesickert – keine Schmerzen - Honig gerochen – Norm zerplatzt - . Als du heimgehst, verbeugt sich vor dir das Gras (17-25). Umgekehrt erscheinen nun sie als die Erde (anstatt Adam aus dem Ackerboden) und er als das Leben (anstatt Eva, das Leben). Aber es ist eine Begegnung und Herausforderung, die er bestanden hat. Ohne zu wissen, was hier geschieht, hat er sich gestellt und bestanden. Das Gras verbeugt sich vor ihm, der das unerkannte Brautgemach verläßt, und Mann geworden kehrt er heim, ohne bemerkt zu haben, wie klein er ist: das Gras.
Diesem (ambivalenten) Sieg folgt sogleich die Niederlage, wenn die Verirrung des Kindes erzählt wird, das dem Vater, Holzfäller, das Essen in den Wald nachtragen soll: er, der keine richtige Sprache har, hat den Weg nicht richtig erklärt:
so daß du schwindlig geworden bist und es dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat (27). Unmittelbar nach der Defloration erzählt, könnte der Schwindel auch von dieser herrühren. Aber der Verirrte taumelt allein durch den dunklen Wald:
Ein Abgrund hat dir entgegengestarrt und ist dir mit seiner Leere ans innerste Leben gegangen, er hat vor dir zu schwanken angefangen, fast hat er getanzt. Du bist größer geworden, und vor den Augen ist dir immer noch der Abgrund, der sich wiegt (28). Aber wieder ist es umgekehrt: Der Abgrund ist des Tjaz´ Ursituation, und im tanzenden Mädchen findet er sie wieder. Der Abgrund der Existenz aber erzeugt Schwindel.
f.
Wie und warum wird aus Tjaz der Kratzende? Er, der Kadavergehorsam von zu Hause kannte,
hat den Predigten und Ansprachen des Spirituals auf den i-Punkt geglaubt (39) – warum ist er nicht in seiner Unauffälligkeit geblieben? Das kirchliche Leben des Internats nennt der Erzähler
eine bloße Herde von Melkkühen, die Bubenschaft nur den ausführenden Teil: denn für das Leben der Kirche ist ein gläubiges Volk nun einmal notwendig, zum Unterordnen und zum Befolgen der Gebote (35). Ist das nun eine Kirchenkritik, verbunden mit einer Kritik am Internat?
....jetzt knieten sie sich nieder und streckten die Zungen heraus, auf daß der Priester einen nach dem andern sakramentalisch belade, worauf dann Reinheit von vorn nach hinten die Bänke durchstrahlte .... wie viele Wege mußten sich kreuzen, wie viele Schritte im Gleichmaß erfolgen, bis der Kirchengeometrie genügt war. (36)
Wiederum ist auf die Subjektumkehr zu achten, die Rechtfertigungsfunktion hat. Die Verlagerung der Verantwortung auf die Umstände und die Umgebung soll entlasten. Der Bericht des Biographs spricht den Zögling frei. Aber die hier genannten Subjekte sind: die Bubenschaft, die Kirchengeometrie. Das sind keine verantwortungsfähigen Subjekte, sondern Verallgemeinerungen. Der einzelne wird in etwas (imaginäres) Allgemeines hineingestellt. Die beladenen Zungen, die bänkedurchstrahlende Reinheit, die vorherrschende Kirchengeometrie erscheinen als imaginäre Subjekte, denen alles Individuelle und Selbständige unterzuordnen ist. Jedenfalls für Zöglinge, die nicht Ich sagen, nicht selbst und aus Eigenem handeln, sondern wegen etwas Allgemeinem und ihnen Fremden. Die Subjektumkehr (Subjektverwandlung) zeigt die fehlende Individuation: als Erziehungsproblem und als pastorales Problem. Wir denken an die Zeiten der Volkskirche und an das kirchliche Leben aus automatisierter Zugehörigkeit, ohne individuelle eigenverantwortliche Glaubensentscheidung.
g.
Ein Unglück, das ihm leibhaftig die Schuhe ausgezogen hat (47), begegnet dem Mitzögling, der unglücklicherweise gerade vor Tjaz zu sitzen kommt. Als dieser ihm unbemerkt die Nägel aus den Lederschuhen zieht, welche auseinanderfallen, wäre er am liebsten
versunken. Nun beginnt Tjaz seine Abgründigkeit und Bodenlosigkeit auf andere zu übertragen, und es wird ausdrücklich als seine neue Aktivität dargestellt, als sein Eigenes, seine neue Eigenheit, das Kratzen, obwohl das doch augenscheinlich gar nichts mit Kratzen zu tun hat. Kratzen ist Zeichen der Wehrhaftigkeit des Unterlegenen, Schwächeren. Kratzen macht nicht stärker, aber sichert einen Freiraum.
Durch das Kratzen ereignet sich verspätet Tjaz´Individuation.
h.
Als der bereits Mann gewordene Tjaz das Mädchenzimmer der nicht unerfahrenen Nini betritt, da hat er zunächst nur Augen für die Zimmereinrichtung. Vielleicht ist es das Individuelle nach den Schlafsälen, die er kennt, vielleicht das Persönliche und Private. Jedenfalls verschafft ihm das Beobachten und Späen einen Freiraum, und es sind nach dem Kratzen die ersten freien Handlungen, die von ihm erzählt werden – und gerade der Widerspruch zum Allgemeinen der Internatsordnung sind das Zeichen dafür, bis zur morgendlichen Heimkehr. Viel Sprechen mit der neuen Freundin war nicht.
i.
Der Höhepunkt des Kratzens, und sozusagen die erste freie und bewußte Tat, ist die Stürmung des Himmels, verbunden mit der Schändung der Heiligen. Tjaz erklettert zusammen mit einem Verbündeten, wahrscheinlich dem Biographen, und im Beisein Ninis, nachts den Hochaltar mit der Säge, und verstümmelt die Heiligenfiguren, die er bisher so wie damals das Mädchen von unten gesehen hat.
Einige göttliche Heilige und Heiliginnen haben noch gewartet und uns ihr Holz angeboten, aber wir haben sie nicht mehr erhören können (96). Das Wachstum des noch klein gebliebenen Tjaz setzt mit den Kratzaktionen ein, und das größte Wachstum, das im Internat möglich ist, führt zu den Heiligen und über sie hinaus, die weiblichen werden gesondert erwähnt. Es erscheint als lustvolle Orgie, und wie als weiterer, besonderer Schritt auf der Himmelsleiter, und ohne einen Schatten von Destruktivität und Rache. Der zu sich gekommene Holzfäller.
j.
Am Ende wird des Tjaz´ Neigung zur Weiblichkeit auf einen noch höheren Turm führen. Und auf die höchste Erhebung des Verbannten wird dessen tiefster Fall folgen, gerade in dem Moment, als er mit dem Biographen zusammentreffen soll. Damit könnte die ganze Biographie als fiktiv erkannt sein, wenn sie nicht als Beschwörung und Rehabilitation des Gefallenen zu verstehen ist. Denn der Tjaz scheint noch immer keine eigene Sprache gehabt zu haben, konnte sich auch mit dem Mädchen kaum verständigen.
k.
Erhellend ist
ihr Bericht, ebenso fiktiv wie der des Biographen:
mit dem Gekratze vervollständigte er sich, formte sein eigenes Leben, hielt sein Geschick im Gleichgewicht(193)- deutet sie, versteht es also und versteht es nicht, ist in einer Weise ihm verbündet und ist es nicht.
Ich verstehe nicht, wie er sich das Leben nehmen konnte, ich habe ihn doch alles tun lassen, was ihm nottat(197), bekennt sie offen und hilflos, und zeigt damit das Drama des Scheiterns
aller: des Vaters, des Internats, der Freundin. Des Tjaz.
Mit
tun lassen ist es nicht getan.
Was war wohl jenes Wort?
Er trug in sich jenes Wort, das ihn letztlich in den Tod trieb(186) - das niemals ausgesprochene, verschwiegene, ungesagte, doch gesagte, unverstandene, entsetzliche, von dem sie fühlte, dass er es
ihr zugedacht hätte:
immerhin jemand, der ICH sagt.
2.
a.
Ein anderer Zögling, und damit soll jetzt des Tjaz` Geschichte von hinten und von innen aufgerollt werden, nämlich der Törleß, erlebt jene "Jahre des Übergangs" in einem Erziehungsinstitut in der Provinz - er kommt sozusagen von der anderen Seite, von der städtischen, wohlhabenden, gut situierten an ebendiese Schwelle, und die Provinz selbst mag dabei die Aufgabe eines Klosters erfüllen, das in seiner Abgeschiedenheit die inneren Vorgänge verstärkt zu Bewusstsein bringt: und er borgt seine Sprache jenem Holzfällerbuben und konzediert gleich zum Anfang dessen Ende:
Wenn man da solch einem jungen Menschen das Lächerliche seiner Person zur Einsicht bringen könnte, so würde der Boden unter ihm einbrechen, oder er würde wie ein erwachter Nachtwandler herabstürzen, der plötzlich nichts als Leere sieht.(16 - Törleß, nach Rowohlt zitiert)
b.
"Von alldem, was wir den ganzen Tag in der Schule tun, - was davon hat eigentlich einen Zweck? ... Man weiß am Abend, daß man wieder einen Tag gelebt hat, daß man soundsoviel gelernt hat, man hat dem Stundenplan genügt, aber man ist dabei leer geblieben, - innerlich meine ich, man hat sozusagen einen ganz innerlichen Hunger...."
Das ist eine Wahrnehmung des Schülerlebens im ganzen, der Betriebsamkeit mit all ihrer inneren Folgerichtigkeit, wahrscheinlich nicht anders als auch ein Berufsleben: es bleibt ohne innere Korrespondenz, es geht ins Leere, es antwortet nichts im Menschen, der Schüler ist zwar tätig, doch nur äußerlich, die Tätigkeiten meinen nicht IHN, er selbst wird nicht erreicht und bleibt hinter dem Getriebe zurück.
"Es ist so: Ein ewiges Warten auf etwas, von dem man nichts anderes weiß, als daß man darauf wartet .... Das ist so langweilig ...." (30f)
c.
Bei Tjaz klingt das so:
Jetzt kamen sie reihenweise nach vorn zu den betonierten Altarstufen, jetzt knieten sie sich nieder und streckten die Zungen heraus, auf daß der Priester einen nach dem anderen sakramentalisch belade, worauf dann Reinheit von vorn nach hinten die Bänke durchstrahlte ... wie viele Wege mußten sich kreuzen, wie viele Schritte im Gleichmaß erfolgen, bis der Kirchengeometrie genügt war. (36) Wieder steht das handelnde Subjekt zur Frage (Subjektumkehr), liegt nicht im Schüler, nicht im Erzieher/Priester – und diesmal kann der Entzug des Subjekts nun ein Tor öffnen zu der wirklichen Misere der Geschichte: Sie entbehrt der Handelnden! Ein Gottesdienst um der Geometrie willen, kein Erziehungsziel, keine Werte, keine Selbständigkeit, kein selbständiges Glauben. Stattdessen Selbstanpassung.
3
a.
Viele würden jetzt gerne auf die bestimmten Bildungsinstitutionen eingehen, die Internate, die Schulen, auch auf Kirche als Institution, auf Glaubens-„Vermittlung“. Und die kritische Schlagrichtung im Zögling Tjaz ist nicht zu verhehlen. Aber zuerst sollte Dringlicheres abgeklärt werden: Es fehlt an
Menschen. Solche, die handeln können, die entscheiden, die Ziele haben, die begegnen können. Menschen mit Freiheit und Selbständigkeit. Dem Tjaz gegenüber ist nur ein Mensch mit seinem Namen geltend geworden, und dieses Mädchen war selbst noch halb Kind, das mit sich machen ließ.
b.
Was nun den Institutionen angelastet werden kann, ist, dass sie zuwenig transzendente Ziele anstreben, zumal den kirchlichen. Denn nicht als Anpassung soll gelebt/gelernt/geglaubt werden, darin liegt kein Sinn, sondern in jedem einzuübenden Vollzug soll das Worumwillen deutlich werden, das erst wäre die wirklich pädagogische und menschliche Aufgabe.
c.
Nun ist gerade am Törleß deutlich geworden, dass erst solche Selbstdistanzierung gültige, weil reflektierte Sprache hervorbringt. Tjaz spricht nicht, er kratzt. Mutter/Vater haben ihm keine Sprache gegeben, und verlassen tastet er nach dem großmütterlichen Urbild einer Zugehörigkeit, ohne einem
elterlichen Menschen zu begegnen, auf schwankendem Boden.
Dass Sprache entsteht, bedarf eines anderen, eines Fremden (des Biographen), obzwar mit unerklärlichem Wissen über des Tjaz’ Geschichte und Herkunft. Möglicherweise ist er ihm doch näher gekommen, als er sagt.
d.
Und wenn es das ist, was bleibt, der Appell an die persönliche Begegnung, die Wahrnehmung des einzelnen in seiner
unsäglichen Not, das Erscheinen des Ungesagten – oder wenn es sogar das ist, dass in der unbeholfenen Subjektumkehr das
bleibend Mystische erkannt wird, dass jenseits des frei und selbstbewußt handelnden Menschen etwas anderes als Subjekt erkannt wird. Aber man soll sich Gedanken machen, wie einer Mensch werden kann, und nicht Funktion, und es ist wohl seit den Zeiten des Tjaz der Individualismus weit fortgeschritten, sogar extrem weit, ist zum wichtigsten immanenten Wert der Gesellschaft geworden, aber noch lange nicht die
Individuation, im Gegenteil. Was heißt nun ICH sagen.
Vergleiche:
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/fleischhacker/374605/index.do?direct=374563&_vl_backlink=/home/bildung/erziehung/index.do&selChannel=
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/384583/index.do?from=suche.intern.portal
weichensteller - 14. Mai, 23:22