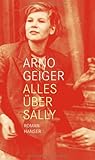Von Tür zu Tür sind wir gegangen und haben angeklopft und angeläutet. Nicht für Geld, nicht wegen Geld, wir haben nichts gebraucht, keinen Dienst, und schon gar kein Quartier. Nur, um uns vorzustellen: Wir kommen von der Pfarre Hlst. Dreifaltigkeit, dort ist unsere Kirche, hier ist der Pfarrbrief, danke, Tür zu, 100 Mal, im Frühjahr und im Herbst. Im Stiegenhaus begrüßen dich Bekannte fröhlich, an der Tür lassen sie dich stehen, ohne zu öffnen. Wie ist das mit dem Öffnen.
In Villach wirst du deswegen so selten eingeladen, weil sie nur eine perfekte Wohnung herzeigen wollen und ein üppiges Essen anbieten, wenn schon denn schon. Der Alltagskram ist nicht zumutbar, wenn das Geschirr in der Abwasch steht, die Kindersachen am Boden liegen und das Katzenklo nicht sauber. Der Mann wird später kommen, ein Anruf steht noch aus, die Kinder haben endlich etwas zu spielen gefunden und sind vor wenigen Minuten im Kinderzimmer verschwunden. Man braucht den knappen Rest seiner Aufmerksamkeit für die Planung des morgigen Tages, die Post, das Einkaufen, das Auto, und was man noch alles vorhatte für heute. Und dann läutet es an der Tür. Was soll das schon wieder. Was denn jetzt noch.
Menschen sind nicht bereit für Begegnung. Mit und ohne Advent führen wir keine offenen Leben. Niemand braucht kommen, den wir nicht eingeladen haben, darum schreiben wir keine Namen und Hausnummern an unsere Häuser und stellen keine Parkplätze für Fremde bereit. Und von denen, die ihre Hungerländer fliehen in Afrika, suchen wir uns die Bestgebildeten heraus, und Tschetschenienflüchtlinge dürfen nur bleiben, wenn sie Morddrohungen nachweisen können oder Folterspuren. Und wenn sie dann da sind, sollen sie schnell Deutsch lernen, unsere Straßen bauen, unsere Büros putzen oder die Autos reparieren, ohne unseren eigenen Kindern die Arbeitsplätze wegzunehmen; und im übrigen sollen sie unsichtbar sein. Das ist unsere Offenheit.
Auf diese Art ist unser ganzes Land zu einer Privatwelt geworden, die von den Lieblingsgerichten der Minister, den Profilierungsneurosen der Kanzler und den Stimmungslagen der Regierungen unterhalten werden. Die Quizmaster sind unsere moralischen Autoritäten, und in der Zeitung steht täglich, worüber man sich aufregt hierzulande, oder worauf man stolz ist, bei winterlichen Sportereignissen. Wie eine Familie, so einfach dieses Land. Wie eine unaufgeräumte Familie, wenn er anklopft, um einzutreten, angekündigt, wenn er um Quartier fragt. Freundlich hört man sich an, was er zu sagen hat, 2 Minuten, danke, auf Wiedersehen. Wenn wir an der Türe stehen.
Wenn wir aber selber zu den Suchenden gehören? Nicht nach Wohnungen, natürlich, wir sind alle untergekommen irgendwie, entweder vorläufig, oder in einer festen Bleibe, und gut geheizt natürlich. Nein, suchend nach etwas anderem: irgendwo erwartet werden. Nicht nur, um jemandem die Zeit zu vertreiben mit Geplauder. Nicht nur, um selbst irgendwie die Stunden zu verbringen zwischen dem Bettgang der Kinder und dem eigenen, und die Wochenenden, wenn alles schon aufgeräumt ist und eingekauft, wenn luftgeschnappt und schigelaufen ist zur Genüge: irgendwo erwartet, bei irgendwem. Jemand, der mich kennt, und dem es um mich geht, um mich selbst, nicht nur um lustige Unterhaltung oder eine Reparatur im Haus, nichteinmal um einen Rat. Um meiner selbst willen erwartet. Für ein Gespräch. Einen Austausch. Was zu sagen ist, und zu fragen.
Wenn wir nun aber selbst solcherart unterwegs wären. Immer noch. Seit Jahren. Und immer weiter gezogen sind, immer wieder aufgebrochen. Und, geben Sie es zu, unterwegs schon öfter das Bedürfnis vergessen haben, seit Jahren schon vergessen: ankommen wollen, erwartet werden, schon seit Kindertagen vergessen, als wäre es jemals beantwortet worden. Und, obwohl das, was man hat, nie genügt, nie wirklich ernst gefragt, nicht weiter gefragt, sondern einfach genommen, was da war, noch mehr vom Gleichen, und damit alles vollgeräumt inzwischen, alles das Gleiche. Wann endlich die wirklich wichtigen Fragen stellen.
Und wenn wir schon keine guten Wirte sind, mit offenen Häusern und Türen, und auch keine guten Reisenden, keine Pilger, die ihre Ziele kennen und hartnäckig auf der Spur bleiben: dann doch wenigstens Hirten: Hirten, diese freiesten aller Freien, auf freiem Feld, in jede Richtung der Horizont offen, einen Tag in diese Richtung, dann wieder dorthin, wo eben Gras wächst, und das ist ja überall, fast überall. Gebunden sind sie nur an die, die mit ihnen ziehen: eine Bindung für unterwegs, mit ein paar schnell zugerufenen Worten erneuert, ein schnelles Einverständnis ohne große Worte. Aber das sind Menschen, die mit sich selbst auskommen. Sie können stundenlang dasitzen ohne eine Beschäftigung. Sie sind in sich selbst daheim, daher ist es nicht so wichtig, wo sich die Herde gerade befindet, und ob man am freien Feld schläft oder in einem Bett, und in welchem.
Von allen sind die Hirten diejenigen, die am meisten in der Gegenwart sind. Ihr ganzes Sein haben sie gesammelt bei sich, da kann jeder kommen, sogar ein Engelsheer, und da kann man jederzeit aufbrechen, und sei es zu einem Stall in der Nähe. Die Suchenden dagegen sind von ihren Fragen umgetrieben, von etwas, das noch vor ihnen liegt und dem sie nachgehen, ohne es zu erreichen. Und die Wirte haben volle Häuser und viel zu verlieren, sie müssen beisammen halten, was sich eingefunden hat bisher, sie machen Türen zu und Grenzen dicht. Nur die Hirten: keine großen Redner, aber Menschen der Tat. Ihnen, den Gewärtigen, hat sich der Himmel geöffnet, und da haben sie den erkannt, der in sein Eigentum gekehrt ist. Bei sich zu Hause, in einem Kinderleben.
Öffnet den Kindern, wenn sie kommen. Es sind Boten, teilt mit ihnen.
weichensteller - 24. Dez, 18:43
Flüchtig/flüssig: Flüssigkeiten und Gase bewegen sich und verbrauchen Zeit, während Festkörper in ihrer Form verharren. Modernisierung wurde stets als Verflüssigung von zu Starrem verstanden: Zerschlagung von Formen. Aber es sollten neue Stabilitäten entdeckt werden:
instrumentelle Rationalität (Max Weber),
determinierende Rolle der Ökonomie (Karl Marx).
Die heutige Herrschaft des Ökonomischen, dessen Ordnung sich ununterbrochen reproduziert, nennt Claus Offe „Null-Option“. Elemente:
o Demontage aller sozialen Verbindungsglieder, weil sie menschliche Handlungsfreiheit einschränken würden,
o Geschwindigkeit, Verschwinden, Passivität (Richard Sennett)
o gesellschaftliche Position MUSS selbst definiert werden
o Eroberung des Raums – Aufteilung der Welt, Ausbreitung der Siedlungen
o Kriege sind keine Eroberungskriege mehr, die Territorium besetzen wollen, sondern rasche Schläge und Verschwinden, um Hemmnisse des globalen Machtflusses zu beseitigen (vgl. Golf I, Balkan, Terrorismus)
o Bodenhaftung verliert an Bedeutung: transnationale Ökonomie
Freiheitsbegriff: Ein Leben auf der Basis augenblicklicher Impulse bedeutet eine geistlose Existenz (Anthony Giddens)
Kritik an der Realität als Pflichtaufgabe der Normalexistenz: wir sind „reflexive“ Wesen in permanenter Selbstbeobachtung und Unzufriedenheit, immer auf dem Weg der Verbesserung (Giddens) – aber die komplexen Steuerungsmechanismen werden nicht durchschaut: Hilflosigkeit (Leo Strauss)
Moderne Gesellschaft ist wie ein Campingplatz: Jeder kann sich dort niederlassen, bekommt Stellplatz, zahlt für Strom- und Wasseranschluß, jeder nach seinen eigenen Plänen. Die Autorität des Platzverwalters wird anerkannt, die Nachbarn sollen nicht laut sein. Aber:
o kein gemeinsamer Hasushalt
o keine Systemkritik, höchstens Kritik der Konsumenten
Der bisherige Typ moderner Gesellschaft, auf den sich die traditionelle kritische Theorie Adornos und Horkheimers bezog, suchte den Totalitarismus:
o die fordistische Fabrik (mechanisierte Menschen)
o Bürokratie (Verwaltungsdienste ohne Persönlichkeit)
o Big Brother als umfassende Kontrolle
o Konzentrationslager bzw. GULag als Belastungstest unter Laborbedingungen
Seit Lessing: Emanzipation vom Glauben an die Schöpfung – zurückgeworfen auf sich selbst – unfähig zum Stillstand: modern sein heißt, sich immer ein Stück voraus sein.
Modernisierung = Selbstverwirklichung der Individuen; statt Kampf um gerechte Gesellschaft nun Kampf um Menschenrechte (eigene Idee des Glücks, eigener Lebensstil)
Die Gesellschaft DER Individuen (Norbert Elias): reziproke Erschaffung der Indiv. durch Gesells. und umgekehrt.
Laufende Individualisierung ←→ Umgestaltung der Netzwerke gegenseitiger Abhängigkeit
Menschen werden nicht mehr in ihre Identität hineingeboren (sozial, beruflich, geschlechtlich) – die frühe Moderne hatte die Menschen entwurzelt, um sie neu einzuordnen: Entwurzelung als Schicksal, Neuverortung als AUFGABE des Einzelnen → reflexive Moderne (Ulrich Beck): Bettenknappheit wie „Reise nach Jerusalem“, immer in Bewegung, kein Ankommen, nur flüchtige Beziehungen, keine Aussicht auf Wiedereinbettung. Also: Individualisierung ist ein Schicksal, nicht frei gewählt.
Tocqueville: in die Freiheit entlassene Menschen werden indifferent: das Individuum ist der größte Feind des BÜRGERS (Person, die ihr Wohlergehen an das der Stadt knüpft) – während Individuen außer Eigeninteressen noch Allgemeininteressen verfolgen: damit füllen sie den öffentlichen Raum.
Die ÖFFENTLICHKEIT wird durch die Privatsphäre kolonisiert: geteilte Intimität als Form der „Vergemeinschaftung“, öffentliche „Interesse“ nur mehr Neugier des Publikums.
Wachsender Widerspruch zwischen Individuen DE JURE und Individuen DE FACTO, die Kontrolle über das eigene Schicksal erhalten. Zerfall des öffentlichen Raums, der zu einem riesigen Bildschirm geworden ist, auf den private Sorgen projiziert werden. Gestaltungsmacht ist daraus verschwunden, keine öffentlichen Anliegen. Selbstgemachte Identitäten: zerbrechliche Partnerschaften, große Erwartungen, kaum Institutionalisierungen.
Ideen der herrschenden Klassen = herrschende Ideen (Karl Marx): heute also nach mehrhundertjähriger Herrschaft kapitalistischer Lenker Totalherrschaft kapitalistischer Ideen:
Fordismus: Rationalisierung und Mechanisierung der Produktion, Trennung von Intelligenz und manuellen Vorgängen, verstärkte Kontrolle, verstärkte Anreize (Bezahlung).
Lenin: „sowjetisches Organisationsmodell“ = wissenschaftliche Arbeitsorganisation außerhalb der Fabriksmauern, mit dem Ziel, das soziale Leben zur Gänze zu durchdringen.
Der „schwere“ Kapitalismus hielt die beschäftigten Arbeiter fest auf dem Boden – heute reist das Kapital mit leichtem Gepäck (Handy, Laptop): ständige Bewegung der Beschäftigten, Güter und Firmen.
(Zygmunt Baumann)
weichensteller - 22. Dez, 21:10
Die meiste Zustimmung fand bisher die These von der beruflichen Überforderung:
+ Konkurrenzdruck zwischen Kunden, Kollegen, Firmen
+ das Bewußtsein, für die Firma nur ein Geldfaktor zu sein, der in Notzeiten jederzeit "abgebaut" werden kann
+ gesteigerter Arbeitseinsatz, wenig Energie für Lebensbereiche außerhalb der Arbeit
+ dermaßen gesteigerte subjektive Bedeutung der Erwerbsarbeit bei zugleich abnehmender Bedeutung des Arbeitnehmers für die Firma
Weitere Thesen:
+ gesteigerter Anpassungsdruck an Lebensformen: Marken-Bekleidung, Autos, Urlaubsreisen usw. legen die finanzielle Latte hoch und verringern Bewegungs- und Erlebnismöglichkeiten;
+ zunehmende Ichzentrierung:
"was gibt ma des" (Qualtinger), vgl. mit vorigem Posting des Scheidungs-SMS!
+ Erlebniszentrierung:
"das Ungeborene hat ein Lebensrecht, wenn es Schmerz ERLEBEN kann...."
"der Behinderte kann vielleicht Glück ERLEBEN" (Argumente ethischer Normendiskussion im RU)
...wenn ich das und das tu, dann FÜHL ich mich wohl
...damit sie sich hier wie zu Hause FÜHLEN (weil dus nicht BIST: sondern fremd hier)
...damit die Menschen das GEFÜHL haben, es wird etwas für sie getan (Politiker-Rechtfertigung)
+ Transzendenzverlust:
"das macht Sinn/ keinen Sinn" (Heide Schmidt)
-> als ob Sinn hergestellt werden könnte!
Vielleicht ist diese Erscheinung die Zusammenfassung aller anderen Beobachtungen.
weichensteller - 16. Dez, 21:06
so begann ein SMS von einem früheren Mitarbeiter, den ich getraut habe:
"Nach 5 Jahren Ehe und gesamt 11 Jahren Beziehung laß ich mich scheiden. Was so leicht klingt war lange von mir überlegt und es ist schwer, aber für meine Seele besser."
So sind Menschen...
weichensteller - 11. Dez, 20:37
Nehmen wir einmal an, die heutigen Menschen wären von ihrem Leben überfordert. Ihnen wäre einfach alles zu viel, der fordernde Beruf, der ihnen alles abverlangt, ihren Fleiß, ihre Kreativität, ihre Kommunikationsfähigkeit. Dann der fordernde Ehepartner, der Ansprüche stellt. Und natürlich der fordernde Nachwuchs, der nicht nur die neuesten Computerspiele beansprucht, sondern auch Zuwendung und Zeit. Halten wir uns gar nicht auf mit Vergleichen zu früheren Zeiten, mit Fabriksarbeit oder Bauernleben, mit Wochenstunden und Arbeitsbedingungen. Denn es könnte ja sein, dass Menschen früherer Generationen andere Ressourcen hatten, und das sie darum Schwieriges anders aufgefaßt haben. Eine Theorie der Überforderung müßte daher nach den Sinnkonzepten fragen, mit denen Menschen ihre Situationen verstanden und bewältigt haben.
Erste Station würde die Theorie bei der Frage der Selbstbestimmung machen, welche die Aufklärung gestellt hat. Die freie Selbstbestimmung der Vernunft ist ja seit Kant die Basis des modernen Subjekt-Konzeptes. Der Mensch entscheide nach Vernunftgründen, nach welchen Richtlinien er sein Leben gestalten wolle, seine Berufsplanung, sein Familienleben, seine Weltanschauung und seinen Glauben. Das setzt ein hohes Maß an Einsicht und Reflexionsvermögen voraus. Umso mehr, als es dieses Menschenbild ja nicht mehr erlaubt, einfach so weiter zu machen: Denn damit ist ja die Tradition diskreditiert. Nur weil die Alten so dachten, ist kein Argument für mich. Und leider, die Umfragen zeigen es sehr deutlich: sie haben keine Argumente! In die Kirche gehen, nur wegen des Glaubens? Leben nach dem Tod? Sündenvergebung? Mission? Der Glaube ist ja eben kein Argument. Ist die Aufklärung an dieser Generation gescheitert?
Aber an unserer Generation: Wir glauben nur, was beweisbar oder argumentierbar ist. Sagen wir.
Irgendeine Station, möglichst eben nicht die erste, würde natürlich auch die Reformation untersuchen. Als Geisteshaltung, die einen Gottesglauben fundieren will außerhalb der rissig gewordenen Tradition, und besonders außerhalb des Dogmas und der Kirchenautorität. Aber diese Bestimmung würde selbstverständlich nicht auf eigene Bestimmung, sondern auf Gnade zurückgehen. Das Fundament dieser Haltung ermöglicht ein neues Schriftverständnis, auch eine neue Schriftauswahl, und besonders eine neue Kirchenverfassung. Es läßt sich das nicht ableiten aus den politischen Bedingungen der Renaissancezeit, sondern enthält ein bleibendes Element neuzeitlichen Menschseins, das in heutigen sehr säkular gewordenen Kirchen wiedergefunden werden kann.
Eine andere Station müßte bei der keimenden Wissenschaftsgläubigkeit gemacht werden, meinetwegen beim beginnenden Empirismus und Rationalismus, aber jedenfalls beim Evolutionsbegriff, der, von der Biologie der Arten ausgehend, heute das ganze Gebäude wissenschaftlichen Denkens und Meinens trägt. Der Gedanke also, etwas wäre verstanden, wenn seine Ursachenkette bekannt wäre, bis zu einem Weltbild immerwährenden Werdens und Vergehens. Dabei können ruhig auch die Grenzen oder Verfeinerungen dieser Erklärungsmodelle durch die Quantenmechanik und Chaostheorie zur Darstellung kommen, die das Bild wissenschaftlicher Rationalität insgesamt aber nicht zur Disposition stellen werden.
Der Hauptteil der Theorie aber sollte sich mit den heutigen Lebensäußerungen beschäftigen. Dabei würden vermutlich die vielen Wahlmöglichkeiten des Individuums in der modernen Demokratie im Zentrum stehen. Denn wenn nicht nur Regierungen und Parteien zur Wahl stehen, nicht nur Berufe und Partner, Kinderwunsch und Lebenskonzepte, Weltanschauungen und Religionen – manches davon erst seit wenigen Jahrzehnten und folglich noch ohne großen Erfahrungswerte -, sondern auch solche Fragen wie nach der Kontaminierung und Herkunft der Lebensmittel oder den Produktionsbedingungen und Transportwegen unserer Elektrogeräte und Bekleidungen: dann steigen die meisten aus. Die Wahlmöglichkeit ist zur Belastung geworden. Die leicht abrufbare Information verpflichtet ja, und die unerträgliche Dauerverpflichtung (ist das schon einmal mit der Leibeigenschaft verglichen worden?) erzieht zur Ignoranz, welche ich als beständigste Haltung erwachsener Individuen erkenne. Haben Sie bedacht, welche Auswirkungen die Information des Arztes an die werdende Mutter hat, dass ihr Kind möglicherweise mißgebildet zur Welt käme, wenn sie das wolle – und nicht dieses Wachstum des neuen Menschenlebens rechtzeitig beende? Dass die Mutter nunmehr die Existenz des behinderten Kindes rechtfertigen muß? Oder die Angehörigen des alten, kranken Menschen dessen Pflege zu Hause oder in der Anstalt? Oder, gestatten Sie diese Argumentation, der Arbeitslose seine erwerbsuntätige Existenz, wie auch die Hausfrau?
Besonders würde ich von einer Theorie der Überforderung Aufschluß erwarten über die Funktionalisierung des Menschen, deren Effizienzkriterien er sich willenlos (oder jedenfalls widerstandslos) zu unterwerfen scheint. Wie kann ein modernes Subjekt sich so bereitwillig den Zwängen der Fabrikation des öffentlichen und privaten Lebens unterwerfen, deren Werbemechanismen und Konsumzwänge so offensichtlich alle Lebensbereiche beherrschen und diese Herrschaft völlig ungeniert und unwidersprochen zu Markte tragen? Warum läßt sich der aufgeklärte Bürger so bereitwillig reduzieren, warum unterstützt er noch seine eigenen Parasiten, die aus ihm jede Eigenständigkeit saugen, um damit ein System zu nähren, den Markt und seinen Wettbewerb, auf dem er recht und schlecht überleben kann, dauernd vom Absturz bedroht? Mit Beifall belohnt wird, wer wieder Pfründe einer Gruppe bloßstellt, um sie gleichzumachen, obwohl wir lieber Überlegenheit durch Leistung und Rücksichtslosigkeit anerkennen als durch Geist – vorläufig wenigstens. Wenn, zumindest in Mitteleuropa, unaufhörlich der Gräueltaten der Nazizeit gemahnt wird, die die anderen begangen haben, so ist eigentlich der moralische Fortschritt im Menschenbild nur schwer zu erkennen, oder im Vergleich zum Imperialismus und zur Kolonialpolitik: nur die Mittel scheinen verändert, kaum die Sprache.
Es dürfte vielleicht nicht so schwer sein, eine solche Theorie überzeugend darzustellen, und ist bestimmt bereits geschehen. Aber die Mittel der Gegensteuerung scheinen doch recht bescheiden, Schule und Politik, gesellschaftsbildende Elemente, noch gerade mit der Effizientmachung des Menschen beschäftigt: und die Kirche? Man möge nicht von der Dringlichkeit der Aufgabe auf den Ernst der Arbeit schließen, auf Einhelligkeit in der Absicht und Einsatz aller Kräfte. Das wäre nämlich ein Effizienzargument.
weichensteller - 5. Dez, 22:05
Martin Koller, der Villacher Rockexport, Jojo Mayer, allemannischer Trommler, und Patrice Moret am aufrechten Bass haben als "fremde Feuerbälle" was vorgegeben, keine Frage.
Aber wieso Rockmusik.
Ich bin kein Musikkritiker, aber mit Rockmusik aufgewachsen und VERwachsen, und ich heiße Rockmusik:
-) was ein Song ist, den man irgendwie nachsingen kann, oder der ein eingängiges Riff hat, muss nicht einmal ein Text sein (je älter ich werde, desto lieber ist mir instrumentale Musik)
-) was einen Beat hat, der in die Beine fährt, und obendrein in den ganzen Körper, welcher graduiert Anteil nimmt (ergreift, erfaßt) bis zum Herzrhythmus
-) eine Mindestgeschwindigkeit; ja, es gibt auch die "langsamen" Songs zum eng Tanzen: aber die haben um nichts weniger Energie
-) was einen zentralen emotionalen Aspekt hat, meist triefenden Pathos, ob von Text, Stimme, Melodie, Verzögerung, Virtuosität
-) den eindeutigen Hang zu Ekstase, auch wenn Lifemusiker cool tun (heizt umso mehr an) oder wenn sie im Studio lässig sind
-) eine wissenschaftlich kaum erklärbare energetische Stimulanz, die schon beim Nachspielen kleiner Passagen übergreift
Wers nicht glaubt, schau sich Videos an von Led Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer oder Deep Purple.
Obendrein hat mich an dieser Musik (nicht an jeder) die Intelligenz fasziniert: ein gestufter Aufbau mit Intro, Thema, Soli, Duetten, Variationen, Zitaten und einem Finale wie der Jüngste Tag.
Was sind dagegen strange balls of fire?
Groovige Klänge wie aus Butter, die von gestrichenen Akkorden kommen. Erinnert mich an Bill Frisell mit frühen, langsamen Stücken, oder an diese drei Musiker, die eine Stunde lang in der Kremser Kunsthalle gesessen sind mit den Gitarren am Knie, und über sie gebeugt haben sie damit Klänge erzeugt: keine Töne, Melodien, Rhythmen, nein Klänge, mit einer Seite, oder mit mehreren, schwebend, gleichbleibend, und natürlich laut.
Die Leute damals in der riesigen Halle waren wie heute: stocksteif dagestanden, stumm geschaut, jeder für sich, kaum eine Regung bemerkbar. Damals hab ich einige angesprochen, heute auch, ganz normale Gespräche möglich, keine Emotionspegel, es gefällt halt.
Ok, die Ausnahmen: Der mexikanische Song vor der Pause: witzig, virtuos, mit wahrnehmbarem Thema (folkloristisch) und beißender Ironie, Erwartungsenttäuschung, anheizend, energetisch, mit unterscheidbaren, aufeinander bezogenen Abschnitten, und einer Einleitungsgeschichte: der Song aus dem mexikanischen Gefängnis, in der Nacht komponiert, vor der Befreiung durch..., und dann ein schlagzeugdominierter Song.
Jojo Meyer erinnert mich an Ginger Baker oder noch mehr an Carl Palmer: eine eigene Welt. Sicher der Anheizer der Band, und Moret der Grundierende, aber es kommt anderes heraus wie bei obgenannten, eben um genannte Differenz. Und versteht mich recht: Energie hat Koller auch, aber eine coole Energie - vielleicht ist das die Weiterentwicklung, wie bei Glühbirnen, kaltes Licht, ohne Wärmeverlust.
Gut, ich nehme ihnen das Experimentelle ab. Rockmusik unter heutigen Bedingungen. Wenn es nur ein Zwischenstadium ist. Ansonsten wäre mir Jazz lieber. Nicht wegen atonaler Elemente, oder weil Tonsysteme unveränderlich sein sollen. Das machen Jazz und zeitgenössische Musik ja schon längst. Auch guter Rock, bereits seit den Siebzigern.
Vielleicht ist es letzlich doch der Beat. Der muss die coolsten Typen aufheizen können. Vielleicht ist das der Rock.
weichensteller - 8. Okt, 22:33
1.) Was bedeutet Dir dieses Blog (wo Du gerade schreibst)?
Einfach Lesbares schreiben, mit Möglichkeit einer Rückmeldung
(Bin immer neugierig auf Kommentare)
2.) Welcher Kommentar hat Dir viel bedeutet oder gut gefallen? Poste ihn!
Z.B. der letzte von Schlagloch (TOTEN.HALLE)
3.) Ist das Schreiben in Deinem Blog Last, Lust, Bedürfnis oder was anderes?
Lust, Experiment, Herausforderung...
4.) Ist Dein Blog "eins unter vielen" oder "ganz speziell"?
Na sicher was Spezielles
5.) Welche Ziele hat Dein Blog?
Schreiben üben , sammeln und lesbar machen
6.) Welche Gegebenheiten könnten dazu führen, Dein Blog zu löschen?
Wenns fad wird oder wenns gar niemand liest oder kommentiert
7.) Wie reagieren Leute aus Deinem "real life" auf deine Blogtexte?
Konspirativ
8.) Könntest Du "blogsüchtig" sein oder werden?
bin ich
9.) Zwei gute und zwei schlechte Seiten am Bloggen?
kreativ, ungezwungen; -- aber nur ein technisches Medium (statt von Angesicht zu Angesicht), nicht so vielen Menschen zugänglich (ich meine lustvoll) - und ich gestehe: in Buchform wärs mir lieber, auch wenn die Antwort dann schwerer wäre, aber Bücher haben in meiner Gültigkeitshierarchie einen höheren Stellenwert...
10.) Verlinke mindestens drei andere Blogger, die Du als Stammleser bezeichnen würdest!
Stammleser hab ich außer der Auftraggeberin nur
https://schlagloch.20six.de/, der selber bloggt; ansonsten NACHTLICHT und OFFENESHERZ, aber die bloggen nicht.
Ich fürchte, das war nicht alles so gemeint.....
weichensteller - 7. Okt, 20:53
Am liebsten hören die Angehörigen, was der/die liebe Verstorbene getan hat im Leben, Verdienste für die Allgemeinheit, meistens aber für eben diese Angehörigen. Ein ganzes Leben für die Familie, immer für uns Kinder da, schwere Zeiten, mit wenig eine Existenz gegründet. Sehr oft muß ich erst nachfragen nach dem Beruf, nach dem früh verstorbenen Gatten. Manchmal ist es den Angehörigen zuwenig, was ich dann über die Vergangenheit sage von den Einzelheiten, die sie mir vorgelegt haben, und zuviel von der Ewigkeit.
Bischof Kapellari hat mich, als ich in Kärnten auftauchte, gewarnt vor dem ausgeprägten Totenkult hier. Es sind stets mehr Menschen am Friedhof als in der Kirche, besonders in den Dörfern. Der bedeutende und einzige Kärntner Schriftsteller, der in seiner Heimat geblieben ist, Josef Winkler, schreibt unentwegt vom Tod.
Der Friedhof ist konfessionsverbindend und generationsverbindend. Am Sarg tritt die verzweigte Familie zusammen. Die Nähe zum Verstorbenen wird am Grab gesucht, nicht in der Eucharistiefeier. Die Nennung des Namens scheint wichtiger als das Gebet. Die Vorstellung, der Tote würde in der Erinnerung leben (vielleicht nur in ihr), kann mit einem Jenseits und erst recht mit der Ewigkeit wenig anfangen.
Der Blick geht zurück, nicht voraus, nach unten, nicht noch oben. Den meisten Menschen würde, dass in der Ewigkeit keine Ehe existiert, weil alle Menschen in Liebe miteinander und mit Gott verbunden sind, blasphemisch erscheinen. Andererseits gibt es aber keine volkstümliche Vorstellung von der leiblichen Auferstehung.
Dabei ist der Tod das einzig sichere und endgültige, das in unserer sich unaufhörlich verändernden Welt existiert. Wir modernen, wissenschaftlich empfindenden Menschen vermessen die Welt bis zu den Atomkernen und meinen, das Geheimnis des Lebens mit den Genen in die Hand nehmen zu können. Wir fahnden nach den Jungbrunnen und wähnen sie in Sport und gesunder Ernährung, in Genuss und Gesellschaft, in Planung und Innovation gefunden zu haben. Aber wir verschieben nur Fristen und dünnen das scheinbar Gewonnene weiter aus.
Es ist der Gegensatz, den wir scheuen. Um ihn zu umgehen, bauen wir Brücken: die Sterbeerlebnisse Reanimierter, die Unendlichkeit des Universums, die sogar mein Schuldirektor mit der Ewigkeit in eins setzt, und er ist Physiker und Mathematiker.
Der fundamentale Unterschied zwischen den schnellen und unbedeutenden Ereignissen unserer Tage und der wesenhaften Stille, die uns erwartet, zwischen der atemlosen Vergänglichkeit und dem Eigentlichen, das wir sein werden, und ganz besonders der Unterschied zwischen unserer Selbstbezogenheit, in der wir das Glück suchen, und der Bezogenheit auf Gott, in der die wirkliche Fülle ist. Und spätestens hier sieht man: Ein Leben, das um die Ewigkeit weiß, verläuft anders und hat eine andere Tiefe als eines, das in der Endlichkeit aufgehen will. Hat man nicht bemerkt, dass jene den Menschen klein machen, die die Ewigkeit negieren, aber im Angesicht des Todes seine Würde sichtbar wird?
Der Oktober wird uns zeigen, wie viele Unterschiede es da im Leben gibt: gegenüber Sterbenden, die aus dem täglichen Leben in Anstalten ausgezogen sind, gegenüber Ungeborenen, die zu einer Krankheit erklärt werden oder gegenüber Leid, das für sinnlos gehalten wird. Und dieser Oktober wird insofern ein kritischer sein, weil im Umgang mit dem Tod ja wir Lebende offenbar werden. Vor dem Schweigen des Todes wird unser Leben umso beredter.
weichensteller - 24. Sep, 14:58