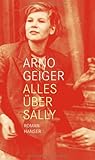Zuerst haben sie wissen wollen. Die Erkenntnis von Gut und Böse. Dieses Wissenwollen sucht die Alternative. Was es noch gibt, außer gut sein. Denn in dieser Welt war alles gut. Auch der Mensch. Die ganze Fülle lag ihm zu Füßen, buchstäblich. Gold und Karneolsteine im Boden, Bäume mit köstlichen, verlockenden Früchten, alle Arten Tiere und Pflanzen. Aber das war nicht genug, der Mensch wollte wissen, was es noch gibt.
- Und damit hat der Mensch die Provinz erschaffen. Das ist die Alternative zum Paradies. In der Provinz geht der Mensch gesenkten Hauptes hinter die Bäume, wenn Gott zu nahe kommt. Ansonsten hat er sich einigermaßen eingerichtet. Zwar muss er alle paar Jahre das Klo neu verfließen oder die Einfahrt betonieren. Draußen ist kein Türschild, und seine Nummer steht in keinem Verzeichnis. An den Feiertagen versammelt er seine Kinder, die ansonsten eigene Wege gehen. Das ist überhaupt die Provinz: dass alle ihre eigenen Wege gehen, und dennoch nicht alleine, sondern zu hunderttausend. In der Provinz gibt man sich’s, möglichst regelmäßig, Eishokeysaison, Faschingssaison, Fleischweihsaison, Kirchtagssaison, Gräbersaison. Seit die Alternative erfunden wurde, will der Mensch nichts mehr wissen. Die Katastrohen in der Geschichte sind ihm gleichgültig. Was seine Väter gemacht haben. Wie die Wirtschaft sich den Menschen organisiert, interessiert ihn nicht. Eilfertig läuft er ihr entgegen, mit dem Einkaufssackerl. Das Fremde in seiner Mitte will er ausmerzen, ohne es zu kennen. Eines Tages wird ihm das auch mit dem eigenen Herzen gelungen sein, er arbeitet daran. Wenn er die Natur teert und betoniert, will er nicht wissen, was darunter und daneben ist. Solange die Berggipfel darüber hinausragen. Selbständiges Wachsen und Sprießen beunruhigt ihn eher. Darum schickt er seine Talente meist in die Stadt, dort gefällt es ihnen, und sie bleiben.
In der Zeit nach Weihnachten finden wir uns wieder als Beschenkte. Auch wenn man nicht wissen will, welches zwölfjährige Mädchen in Thailand den Pullover genäht hat, für einen Euro für einen Zehnstundentag. Und täglich nicht wissen will, wie die afrikanischen Flüchtlinge in ihren Baracken leben in den spanischen Glashäusern, wo sie unser Wintergemüse ziehen auf Steinwolle. Und weiters wissen wir nicht, wie lange wir unsere Jobs behalten werden (außer mir selbst, ich habe eine krisensichere Branche gewählt). Und welche globale Krise nach der Welterwärmungskrise und der Finanzkrise die nächste sein wird. Vielleicht ist es die Freiheitskrise. Wo wir mit unseren stetig angewachsenen Alternativen nichts mehr anfangen können, so wie mit 100 Fernsehprogrammen. Vielleicht werden wir eines Tages gar nicht mehr anders können wollen. Sondern geradeheraus das Richtige tun, das, was uns selbst zutiefst entspricht. Und ohne es zurückzunehmen, ein eindeutiges Ja sagen. Und, anstatt sich fortwährend selbst aufs Spiel zu setzen und sich immer wieder zu verlieren, dann endlich wieder wissen wollen, nämlich: Wie soll das geschehen.
Wie soll solcher Wandel stattfinden? Bestimmt ist das nicht erlernbar, durch kein Schulsystem. Oder erstrebbar wie eine Karrierestufe. Es lässt sich nicht ausrechnen wie eine Wirtschaftsprognose, nicht erkämpfen wie ein Wahlsieg. Solche Überwindung der Provinz gibt es wie jede Bekehrung nur aus Gnade. Ein Geschenk, das unerwartet plötzlich da ist. Öffnen und verwenden musst du es selbst.
weichensteller - 14. Dez, 21:18
Es gibt auch positive öffentliche Darstellungen kirchlichen Lebens und Denkens in der Tagespresse:
https://www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultur/1617334/index.do und
https://www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultur/1617334/index.do?seite=2
Hier fragt Erwin Hirtenfelder behutsam und einsichtig einen der Großen der Kärntner Kirche, und bekommt Antworten, die gar nicht zu einer kleinen Tageszeitung passen wollen: vorsichtige, umsichtige, differenzierte; Antworten, die im selben Zug die eigene Position und die Gesprächssituation in Frage stellen: "Wenn ich sagen würde, ich wähle ihn nicht...", Antworten, die sich über das Interview hinaus eigentlich in der ganzen Zeitung einnnisten und festsetzen, weil sie schnelle Zuordnungen vermeiden und Verschließungen verweigern: Er lässt sich in keine Ecke drängen, Colerus-Geldern, will stattdessen der Umkehr dienen, beschuldigt nicht, versteht die moralische Mangelsituation - und am Ende hat er sich in einer unerwarteten Wendung gar selbst in Stellung gebracht als möglicher Parlamentsseelsorger! (Ein Lob dem Fragensteller)
Der zweite Bericht des Jahres (nach meiner Wertung), kurz danach erschienen, präsentiert den Pfarrer von Radenthein, wie er leibt und lebt:
https://www.kleinezeitung.at/kaernten/spittal/radenthein/1625847/index.do
Da lacht mir das Herz, wenn er rockend und busfahrend daherkommt, und wenn er
SEINE Schule präsentiert, die er sich gekauft hat, weil niemand in das leere Gebäude mehr investieren wollte, wie auch in die Jugendlichen dieses Landstriches. Da hat Simonitti wahrlich eine Schule gegründet, in der zu lernen ist. Dass es oberste seelsorgliche Aufgabe ist, zu fördern. Dass es möglich ist, mit 37 jugendlich unbeschwert Pfarrhöfe auszumisten oder Rockmusik zu machen. Dass nicht alle jungen Menschen saturiert und gelangweilt sind, und dass es möglich ist, sie zu gewinnen. Besonders aber zeigt er, dass es höchsten Ernst braucht und beinharte Konsequenz, um sich über die vielen Hindernisse hinwegzusetzen, die von Eltern, Behörden oder Kirchenleitungen aufgebaut werden, oder einfach und womöglich noch schlimmer, über das Unverständnis und Desinteresse.
Und nicht nur wegen Gerhard ist das ein Rekordbericht, auch wegen Manuela Kalsers Entschluss, auf eine reißerische Darstellung zu verzichten (wer hat da den Fallschirmspringer verschwiegen?) und auch seine Gegner zu zeigen, das Riskante seines Einsatzes und das Unabschließbare eines solchen Weges, und folgerichtig endet sie mit guten Wünschen für die Zukunft.
Beide Medienereignisse markieren mir eine Wende. Hatten wir uns noch im Kritischen Oktober beklagt über die flache, eng vordefinierte Kirchendarstellung
https://www.kath-kirche-kaernten.at/pages/bericht.asp?id=12860,
so öffnen sich hier wahrlich neue Welten, abseits von Brauchtumsromantik und Obrigkeitsberichterstattung, Skandalgekratze und Konzertvorschau. Eine um Objektivität bemühte Geschichtsdarstellung schwieriger Zeiten, die eine persönliche Zukunft eröffnen könnte, und eine Persönlichkeitsdarstellung, die einen jungen pastoralen Stil markiert: solches Schreiben ist nicht mehr der Unterhaltung, sondern der
Wahrheit verpflichtet, und ist im besten Sinne konstruktiv.
Alle Achtung.
weichensteller - 18. Nov, 21:38
https://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/426838/index.do
Der Strasser ist ein Schwätzer, ein Gscheiterl, wie die Wiener sagen. Kreist wie ein Habicht um den Hühnerstall der Religion, aber kommt nicht hinein, weil er die bequeme Philosophenluft nicht aufgeben will. Dabei bräuchte er nur einmal in die Messe zu gehen, an Tagen wie diesem, da bekäme er genug Stoff zum Tod, über den er sich ausläßt, ohne etwas zu sagen. Als Meister der Fläche ist er eher Geometer als Philosoph, denn da fehlt beides: Liebe und Weisheit. Wie will man denn etwas Gültiges vom Tod ausmachen ohne Metaphysik! Naturalisten und Fundamentalisten sind Flächenbewohner wie er, da dachte Schopenhauer noch riskanter, der Maulwurf, der an die Oberfläche kam und die Tiefe des Bodens vergaß.
Strasser ist ein Muttersöhnchen, ohne den Ernst für Wahrheit und Verantwortung. Deshalb muss er jeweils im ersten Absatz die Religion kaltstellen, um dann seitenlang in der Asche herumzustochern. Ich halte sein Schreiben für Glaubensersatz, denn auf einen personalen Gott kann er sich nicht beziehen. Kann man sonst in einem Essay über Leben nach dem Tod schwadronieren, ohne den Auferstandenen zu erwähnen? Über Bewußtseinszustände von Toten fabulieren, ohne über Ewigkeit zu sprechen?
Ich halte das Ganze für fahrlässig. Ein zynisches Aburteilen der tiefsten Glaubensüberzeugungen des christlichen (jüdischen und islamischen) Abendlandes / Morgenlandes. Und es ist kein Zufall, dass stets Zyniker und Nihilisten wie er ums Wort gebeten werden. Programmatische Verflachung des Abendlandes.
weichensteller - 1. Nov, 20:55
So wie ein schönes Bild von einem besonderen Bilderrahmen eingefaßt wird, so sagt der Rand der Gesellschaft sehr viel aus über die Menschen „in der Mitte“, über ihr Zusammenleben und ihre Umgangsformen. Ein Volk, das Menschen verhungern ließe, würde zeigen, dass es unfähig ist, seine Bevölkerung zu ernähren – oder die Nahrung gerecht zu verteilen. Das ist gottlob bei uns nicht so.
Was aber ist mit einem Volk, das seine Ungeborenen tötet? Das Ausländer einlädt, statt des eigenen Nachwuchses bei ihm zu leben und zu arbeiten, und diese dann loswerden will? Ein Volk, das Behinderte gar nicht auf die Welt kommen lassen will, und wenn doch, dann mit Mauern umgeben. Das seine Kranken nicht sehen will, und seine Sterbenden in weiße Zimmer sperrt.
Nun, es gibt viele Menschen, die sich aufopfernd bemühen um Alte, Kranke oder Sterbende. Die öffentliche Diskussion hat das leider nur in Eurobeträge fassen können, was doch menschliche Hingabe ist. Und auch wenn die von den gewinnorientierten Massenmedien verkündete „öffentliche Meinung“ nur Spaß und eigenen Vorteil sinnvoll nennt, gibt es doch sehr viele Menschen, die wissen, dass Glück und Sinnerfüllung eine Frage der Liebe sind. Menschen, die einander pflegen. Die darauf achten, dass ein anderer leben kann. Menschen, die auf die Suche gehen nach Schwierigen. Die sich Zeit nehmen. Die für Lebenschancen der ihnen Anvertrauten kämpfen. Die also zum Rand gehen, um die Mitte zu stärken.
Und denkt an die, die sich abmühen, damit wir zu essen haben. Nicht in klimatisierten Büros, sondern am Traktor, bei jedem Wetter, jeden Tag. Die mit der Natur umgehen können mit ihren Händen, und den Boden pflegen, damit dort wachsen kann, was uns nährt. Keine Industriearbeiter, die Küken auf Förderbänder stopfen oder Ferkel in Zwinger sperren zu Tausenden. Sondern Bauern, Landwirte, die seit Jahrtausenden dem Leben der Natur und des Menschen dienen. Und seht, wo sie selber stehen in unserer modernen, synthetischen Gesellschaft. Sucht ihre Produkte in den Supermärkten. Und begeht ihre Felder.
Die Wächter über den Rand sind in der Bibel die Propheten. „Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen verfolgt und die Armen im Land unterdrückt!“, mahnt Amos (8,4). Ihre „Schuld war, dass sie in Überfluß zu essen hatten und in sorgloser Ruhe dahinlebten, ohne den Elenden und Armen zu helfen“, erklärt Ezechiel den Zusammenbruch der Gesellschaft (16,49). „Das ist ein Fasten, wie ich es liebe“, richtet Jesaja den Selbstzufriedenen von Gott aus, die obdachlosen „Armen ins Haus aufzunehmen!“ (58,7). Denn eigentlich, so verweisen sie alle auf das Gesetz, „sollte es bei dir gar keine Armen geben!“ (Dtn 15, 4). Jesus nennt die Armen selig und sucht vor allem sie und die Sünder. Denn eine Gerechtigkeit, die Gott anerkennt, kann sich mit verkommenen Rändern nicht abfinden. Denn Gottes Bild vom Menschen ist randlos.
Da wir wohlhabenden bürgerlichen Menschen uns vorwiegend mit uns selbst und unseren Bedürfnissen beschäftigen, sollen wir öfter auf die hingewiesen werden, die am Rand sind, fast schon unsichtbar und von Institutionen zugedeckt. Jemand wird sich schon kümmern, und die Allgemeinheit zahlt ohnehin. Gott aber schickt nicht Geld, sondern Menschen. Menschen, die lieben können. Und Gott bereitet Familien und Gemeinden, damit dort Menschen lieben lernen. Lernorte der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit. Des Hinschauens und Hingehens.
Als in den Pyrenäen die Mutter Gottes einem Menschen erschien, da war es nicht ein Bürgermeister oder Bischof, kein Firmenchef oder Chefredakteur, sondern ein vierzehnjähriges, asthmakrankes armes Mädchen. Durch sie, Bernadette Soubirous, sprach Maria zur ganzen Kirche und fegte sie rein wie mit einem Besen. Und Papst Benedikt ist ihr dorthin an den Rand gefolgt, zu den Kranken und Hoffenden, und hat sich dadurch selbst zum Rand rechnen lassen, was uns die Medien täglich vorzeigen: Ihr Christen, merkwürdige Sondererscheinung! Neidisch kommentiert die Nachrichtensprecherin im ZIB 1 am Sonntag: „Es kamen mehr Menschen als befürchtet....“! Sarkastisch titeln die Zeitungen mit „Papst im Land der Skeptiker“, um die eigene Skepsis hochzuhalten. So, liebe Christen, stellt man uns an den Rand. Im eigenen Land. Vor den Moslems, die unsere Skepsis und Dekadenz verachten. Vor den Ungläubigen und Zweiflern. Und vor den Suchenden, damit sie aufhören, weiter zu fragen. Kämpft dagegen, laßt euch nicht mundtot machen, aber verzagt nicht deswegen: Besser, am Rand zu sein, in guter Gesellschaft, als in der Mitte und leer.
weichensteller - 2. Okt, 21:25
Vor Zeiten hat man sich die Welt wie eine Insel vorgestellt, von Wasser umringt, und der Himmel auf Berge am Rand gestützt. Klar umgrenzt von der Seite, von oben und von unten. Heute reden wir vom grenzenlosen Universum ohne Oben und Unten.
Aber das Denken hat sich nicht geändert, der Mensch ist gleichgeblieben. Als die Schiffe nicht jenseits des Atlantik hinunterfielen, hat man eben die Menschen herabgesetzt, die man in den neuen Ländern gefunden hat, und da hat die ganze Gesellschaft noch viel tiefer zu fallen begonnen, als von den Schiffen je befürchtet.
Die Ränder sind seither keineswegs verschwunden, sondern noch viel enger zusammengerückt. Die Berge, die an den Grenzen der Welt einst den Himmel getragen haben, verbarrikadieren nun unsere Heimat, die wir uns im Gelobten Land geschaffen haben, und sie tragen keinen Himmel, nur unseren Reichtum. Aber die Schutzzäune umgeben auch unsere Häuserblocks, sie sind quer durch Familien und Paare gespannt, und sogar die Herzen sind gepanzert, man sieht das am harten, unbeweglichen Gesicht.
Am Rand draußen haben wir im 16. Jahrhundert die Indianer gefunden, heute sind es Tschetschenen, unproduktive Senioren, unberechenbare Kinder oder unangepaßte Gläubige. Eigentlich fast alle. Nur in der Mitte, da ist das Wichtigste. Was da ist, das sollte im Laufe des Kritischen Oktober 2008 allmählich klarwerden. Wenn wir die Ränder unserer Gesellschaft beleuchten.
weichensteller - 2. Okt, 21:17
Visionen von Πατμος
Ein Gefängnis war das einmal, ein Verbannungsort, diese Insel – und heute noch ist sie nur mit dem Schiff erreichbar, dreimal pro Woche. Den man hier kaltstellen wollte, diesen Propheten, als das Christentum zwar schon verbreitet, aber nur eine kleine Minderheit im Römischen Reich war, das war ein Mann namens Johannes. Aber einen überzeugten, leidenschaftlichen Christen auf einer Insel kaltstellen? Gerade hier hatte er seine Visionen, vom himmlischen Thron, vom Kampf der großen Tiere, von den sieben Posaunen und den Zornesschalen, vom Ende er Welt. Er schrieb sie auf und schickte sie in Briefen an seine Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Wir lesen sie heute im letzten Buch des Neuen Testaments, der Apokalypse, und finden sie an die ganze Kirche gerichtet.
Ihr Christen in Völkendorf, erfahrt, wie wir hier leben, inmitten der Griechen, die selbst Urlaub machen, und der Fremden, die hergekommen sind, weil diese kleine Insel ein Geheimtip ist mit wenig Attraktionen und kleinen Hotels. Kaum jemand von ihnen interessiert sich für die 365 Kirchen, eher für das Johanneskloster, dessen mächtige Mauern die Insel überragen und einmal Seeräuber abwehren sollten, aber den steilen Weg hinauf, und bis in die überraschend kleine Kirche gelangen dann doch nicht viele, wozu auch, ist nicht jede dieser orthodoxen Kirchen irgendwie gleich? Lieber bleibt man unten in Σκαλα - Skala, dem malerischen Städtchen am Hafen, mit seinen Gassen, Cafes und Tavernen, und geht einkaufen, essen und trinken – wie zu Hause.
Wer den Thron Gottes zu sehen vermag, und ihm standzuhalten: das sind nicht die unbeschwert schwatzenden Scharen, die dahin treiben und dorthin – da mußt du schon selbst aufrecht stehen können, lieber Christ. Zu solchen, die tun, was alle tun, spricht keine Stimme, oder sie erreicht sie nicht, die gehen, wo alle gehen. Sich selbst für einzigartig halten, genügt da nicht, und dann nur ein Abziehbild sein. Wer in den Thronsaal geladen wird, wird sich als Christ bewährt haben. Das Maß der Christen, hört das aus Patmos, ist nicht Erfolg oder Anerkennung, sondern Liebe und Hingabe, wie wir von Christus sehen, bis zur Selbstaufgabe, so sagt der Seher von Patmos. Und wenn ihr belächelt und verspottet werdet. Ihr gehört nicht zu jenen Selbstvergessenen, ihr gehört zu Christus. Ihr gehört ihm, laßt euch das gesagt sein.
Ich weiß schon, dass ihr viel leistet in eurer kleinen Gemeinde im großen Stadtteil, und dass ihr euch einsetzt für die Kranken, für die Alten, für die Kinder und Jugendlichen, sie sucht und auf sie zugeht, sie ansprecht und ihnen das Evangelium verkündet. Und dass ihr auch abgewiesen werdet an den Türen, und Mißerfolg und Spott einsteckt, zumindest einige von euch. Aber es sind auch solche, die alles recht leicht nehmen, weder kalt noch heiß. Passt auf, dass ihr eure erste Liebe nicht vergeßt, als ihr gläubig wurdet und Christus erkanntet, und wie ihr damals staunen konntet über seine Größe und Macht, als er doch als einfacher Mensch auf Erden wandelte. Werdet endlich wach, ihr Dämmernden, ihr Stolpernden, wacht auf und erblickt, was wahrhaft vorgeht in der Welt und in eurer Stadt! Der Hass gegen euch Christen ist größer geworden, man will euch schaden, wo man kann, man macht euch klein und erniedrigt euch, die Gegner des Papstes sucht man, wenn er spricht, des Bischofs, wenn er entscheidet, die Fehler der Priester, die Schwächen der Kirche – um von den eigenen Schwächen abzulenken. Aber nicht euch hassen sie, sondern Gott, der ihnen seinen Sohn ausliefert.
Seid getrost. Sie werden Gott nicht besiegen, nicht töten oder abschaffen, nachdem sie ihn zu einem Wunsch nervenschwacher Menschen erklärt haben. Diese Kräfte, die in der öffentlichen Meinungsbildung am Werk sind, und die sich der Journalisten, Politiker und Prominenz bedienen, die aus Menschen Konsumenten machen, aus Wählern Stimmvolk, die sind schwach und arbeiten deshalb geheim und versteckt. Sie scheuen Vernunft und Erkenntnis, und vor Gott wird ihr Stolz zerfließen.
Lasst euch gesagt sein: wenn ihr bei den Geretteten seid, die in den Thronsaal gerufen werden, dann seht ihr, wie viele ihr seid, nicht nur eine kleine Schar, wie es jetzt scheint, wenn ihr vereint sein werdet: ein ewiges Glück wird es sein, mit Gott auf seinem Thron, und eins mit sich und Ihm und Allem. Christen!
Seid gegrüßt und ermutigt aus Patmos.
weichensteller - 4. Sep, 00:03
Ist es Uebermut?
Nichts zu sehen, nichts sicher zu wissen, nur eine Vermutung,
und dann sich auf ein so unsicheres Element hinauszubegeben, und auf solche Weise.
Zwar ist er ja ein Fischer, und er wird Erfahrung haben mit diesem Element, wenngleich er aber kaum schwimmen kann.
Aber gerade in dieser Nacht plagen sich die Fischer mit Gegenwind und hohem Wellengang. Das Element hat seine eigene Dynamik. Man lernt, sich ihr bis zu einem gewissen Grad anzuvertrauen, und dann kann man mit ihm umgehen, soweit es das zulaesst.
Und wie kommt Petrus in dieser Nacht zu seiner (spaeten) Jesuserkenntnis?
Die Gestalt auf dem Wasser wurde ja fuer ein Gespenst gehalten, in grosser Angst schrien sie - und versuchten, es so zu beschwoeren. In dieser Nacht, im Kampf mit dem Element, im Anblick dieser unsicheren Gestalt, gab er sich zu erkennen. Und er war trotz der Umstaende erkennbar, weil es ja ein Wiedererkennen war.
Die Israeliten haben bereits in der Nacht des Schilfmeeres Gott erkannt im Walten dieses Elements, das zuweilen traegt und zuweilen verschlingt. Gottes rettende Hand, obgleich gar nicht zu sehen. Vom anderen Ufer aus. Als Gerettete. Als von Fremdherrschaft Befreite. Das war die Gestalt, die sie gesehen haben hinterher, je spaeter, desto besser. Vielleicht erst richtig in der Exilszeit. Die Gestalt des Retters und Befreiers, der sich ihrer annimmt, sie aber auch herausfordert. Im Exil begann man sogar, das Element (probeweise) mit der Wueste gleichzusetzen. Was ist mit dir, Wasser....., was ist mit euch, Berge..... (Ps 114).
Weiters haben die Fischer Jesus auf dem selben See bereits als der Elemente Herr erkannt. Die Eigenstaendigkeit der Elemente erwies umso deulicher seine eigene Eigenstaendigkeit gegenueber den Fischern und den Elementen, im gleichen Boot damals. Aber nun: Auf dem selben Element ruhend, mit dem sie ringen. - Insofern ihnen gegenueber, und es kommt zu einer Konfrontation.
Aber derselbe Grund traegt sie beide - insofern also eine Gleichsetzung.
Und das ist nun der Grund fuer die Zuversicht des Petrus. Er hat den verbindenden, tragenden Grund erblickt, der das Schiff traegt und sie selbst, und dem auch Jesus sich anvertraut. Im WAlten des Elements Gottes rettende Hand erkannt, in der unsicheren Gestalt wiedererkannt. Jesus in der rettenden Hand Gottes. Der Auferstehungsglaube bahnt sich hier an, auch der Juenger Nachfolgeangebote ueber den Tod hinaus. Der Elemente Herr, und in ihrem Walten erkennbar. Im Tragen und im Hindern. Als Boden und als Grab. Als tragender Grund, und als verschlingender.
Und nun wir selbst.
Ohne sich mit dem Element zu befassen, koennte man gerade nur an Deck bleiben. Von dort koennen zwar Ufer und Haefen anvisiert werden, auch Fischgruende lassen sich eingrenzen - aber das Element wird nur vorausgesetzt, es selbst wird nicht erfasst. Man kann sich darauf bewegen, ohne seiner gewahr zu werden, man geht seinen Tagesgeschaeften nach und kann es dabei zu Geschicklichkeit und Erfolg bringen, und dennoch blieben die Fischer Nichtschwimmer. Denn das Element erschliesst sich nur in der Gotteserkenntnis.
Aber es traegt. Es oeffnet Wege, fuehrt Suchende und Fragende, und auch Jesus betritt es. Und es nimmt auf: Beginnt, Petrus aufzunehmen, als er zweifelt, nimmt die Toten auf, auch den Gekreuzigten - und gibt sie wieder frei:
Das Element, das die Fischer traegt zu Jesus, der Boden, auf dem wir wandeln in all unseren Nichtigkeiten, da wir uns immerfort im Boot festzumachen suchen, und dort Gelaender und Gebinde errichten noch und noch, und mit ihnen allesamt schwanken unentwegt, der Grund, der Gott selbst uns ist, und dem ganzen Universum, jeglichem Geschoepf, damit es darauf erscheine und wieder darin aufgenommen werde.
Aber wenn er sagt: Komm, dann solltest du ihn wiedererkennen, nicht Gespenster, und dann geh, du wirst nicht versinken.
(Auf hoher See geschrieben)
weichensteller - 16. Aug, 19:30
schreibt Geiger nicht. Was heißt schon gutgehen.
Eher lässt sich nachvollziehen, was jeweils fehlt zum Glück. In den Kriegs- und Nachkriegsgenerationen einer Wiener Familie.
Ich erfahre: Welche Hintergründe es hat, wenn gut situierte Menschen mit ihrem eigenen Leben kaum zurechtkommen. Welche Spannungen auf Menschen lasten, die Bewegungsfreiheit haben. Wie Menschen abgeklärt werden, sobald sie die immer wiederkehrenden Reaktionen ihrer Partner durchschauen, und wie zynisch. Und wie hilflos diejenigen sind, die sie nicht durchschauen.
Und wie tapfer eigentlich alle sind.
Wird es genug sein, sie so zu belassen?
weichensteller - 4. Jul, 00:17
Wir Zaungäste der Europameisterschaft. Delektieren uns an den Emotionen der anderen. Die noch etwas zu hoffen/ zu gewinnen haben. Minutiöse Berichte der Vorbereitung der Spieler (seit Monaten täglich). Beobachtung der angereisten Fans: ihr Patriotismus/ ihr Konsumverhalten/ ihre Freude/Enttäuschung, jeweils in Großaufnahme.
Ach ja, unsere eigene Mannschaft. Das Fitnessbarometer anstelle der Klasse. Die Sensation des ersten und einzigen EM-Tores aus dem geschenkten Elfmeter in den letzten Spielsekunden. Das Lecken der Wunden, die uns Schiedsrichter, Schicksal, Pech zugefügt haben. Das Vergessen der eigenen Mittelmäßigkeit. Wir Österreicher wie der Portier beim Opernball, der sich zu fortgeschrittener Stunde auch einmal auf die Tanzfläche wagt.
Die Parteinahmen: Wir Zuschauer begeistern uns immer für diejenigen, die immer gewinnen: großes Mitleid für Franzosen und Italiener, wenn sie verlieren, nie für Mannschaften, mit denen wir es selbst aufnehmen könnten, nie für unseresgleichen, immer für die Sieger, die Mächtigen und Reichen. Die Spanier, die uns seinerzeit mit 9 : 0 abgefertigt hatten. Und wehe dem, der Schwäche zeigt, der nachdenkt, hinterfragt, der nicht über Leichen geht und nicht mit allen Mitteln den Sieg erzwingt: der bekommt Häme und Spott, dessen Schwächen werden genüßlich breitgewalzt, wochenlang, monatelang.
Wir Kirche haben Erfahrung damit. Wenn wir jahraus-jahrein ruhig und berechenbar geradeaus gehen, werden wir gerade noch stumm registriert wie die Bauwerke neben der Straße; allenfalls kleinere Konzertereignisse oder Wallfahrten oder renovierte Kirchentürme werden neben Käsefesten und Bordellraufereien mit kleinen Berichten versehen und in der Wahrnehmungskategorie des leicht Absonderlichen eingeordnet. Aber sobald irgendeine Tür einen Spalt sich öffnet und ein Unbeteiligter einen Blick erheischt, werden Autobeschaffungen und Postenbesetzungen zu geheimen Offenbarungen gemacht, an denen sich alle diejenigen lang- und breitsehen können, die keinen Zugang zu regulären Offenbarungen des Himmels haben.
Über dem ganzen Zusehen ist nirgendwo ein Handeln zu sehen gewesen, es sind lauter sich selbst reproduzierende Ereignisse, heute heißen die Gegner ..... und ....., und die Spiele haben die täglichen Quizshows und Seifenopern anstandslos ersetzt und werden schließlich wieder von ihnen abgelöst werden, und was da jeweils stattgefunden hat, wer soll sich das alles merken, in der nächsten Staffel ist ohnehin alles wieder ungültig.
Das totale Zusehen hat längst aus allem ein Bild gemacht, der Unterschied zwischen einem Stadionbesuch, einem öffentlichen Videostand und dem Fernseher liegt in der Lautstärke, der Bierverpflegung und den Wiederholungen in Großaufnahme. Auch unsere eigene Bildwerdung ist weit fortgeschritten, unsere Bedürfnisse erscheinen täglich im Werbefernsehen, und der Sinn unseres Lebens wird im gesteigerten Privatkonsum und im Wirtschaftswachstum angegeben. Was Wohlgefühl und Glück, Schönheit und Erfolg sind, liest man aus Bildern.
Wo sind die Bilderalben des geglückten Lebens? Des sinnvollen Einsatzes in Beruf, des sozialen Engagements in der Freizeit. Der gelingenden Partnerschaft. Der orientierungsgebenden Förderung der Heranwachsenden. Bilder des selbstbewußten freien Menschen, der lange überlegt hat und nun weiß, was er tut.
Wir Abbilder der Bilder.
Wir Zuschauer.
weichensteller - 16. Jun, 16:49