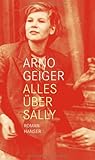II. Individuum und Glaube
k.
Über das Individuum wäre überhaupt nichts auszusagen, meinte Platon, weil seine Einzelheit dem allgemeinen Begriff unzugänglich ist. Erkennbar sind demnach nur Formen (Ideen) – und empirische Gegenstände nur dann, wenn sie in eine Form gefasst werden können: individuum est ineffabile.
Auch das Mittelalter ist gegenüber dem Einzelnen skeptisch. Thomas stellt es in die logische Reihe von genus – species – individuum und hält „dieses da“ ist seiner konkreten Einzigartigkeit für nicht mitteilbar.
Von Aristoteles bis Kant erweist sich der Begriff „Individuum“ als Grenzbegriff, der Erkennbares von Unerkennbarem, Sagbares von Unsagbarem unterscheidet – als Begriff, nicht als reales Ding. Individuum ist demnach weder definierbar noch beweisbar, und daher auch kein Gegenstand der Metaphysik.
l.
Die Unmöglichkeit, ein Individuum zu sein, ist für Elfriede Jelinek eine geschlechtsspezifische. Mann ist Subjekt und verfügt über sich und die Frau, Frau wird verfügt (Janet Blanken, 1994).
kein mensch käme auf den gedanken dass gerda oder ingrid etwas zu sagen haben wenn sie den mund aufmachen. gerda und ingrid schweigen besser. das reden sollten sie jenen überlassen die es gelernt haben. und das sind eine ganze menge. wenn gerda oder ingrid versuchen wie im fernsehen oder im kino zu sprechen dann wissen sie gleich nicht weiter und müssen sich schämen. manchmal glauben gerda und ingrid dass es zwei verschiedene arten von sprache geben muss. diejenige die sie sprechen und diejenige die die andern sprechen. die andern vom fernsehen sind fast so anders wie der herr chef oder die junge frau patrizia. (Michael, Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft, 1972)
m.
Ganz anders sieht Kierkegaard das Individuelle begründet - oder verfehlt: Der Glaube ist nämlich dieses Paradox, dass der Einzelne höher steht als das Allgemeine (FZ 50) – man denke an den mittelalterlichen Diskurs zur Nichtmitteilbarkeit des Individuums – und das dadurch, dass der Einzelne ... sein Verhältnis zum Allgemeinen bestimmt durch sein Verhältnis zum Absoluten (FZ 64). Kierkegaard führt das beispielhaft an Abraham vor, der Isaak zu opfern bereit ist angesichts der absoluten Forderung, die ihn sprachlos macht vor Frau und Sohn, und die nicht vernünftig mitteilbar ist, oder an Tobias, der im Verhältnis mit dem Absoluten, mutig auf Saras Dämonen zutritt und sich ihnen aussetzt.
Gegenüber dem Allgemeinen, dem System, der Objektivität, sei gerade das Subjektive die eigentliche Qualität des Glaubens (besser: die eigentliche Glaubensdimension). Es ereigne sich im Wagnis, in der Entscheidung, in der Hingabe: Aber dann ist ja das Subjektivwerden, als ganz ausreichend (quantum satis) für ein Menschenleben, eine sehr preiswürdige Aufgabe. (unPB I 153)
Der Begriff des Handelns unterscheidet sich hier von dem Jelineks, die einen Bezug auf das Absolute nicht gelten lassen kann. Möglicherweise liegt aber gerade in ihrer marxistischen Position zwar die Möglichkeit der Kritik der bestehenden Verhältnisse, aber auch die Unmöglichkeit ihrer Überwindung. Sobald man weiß, wie ein Individuum existiert, weiß man auch, wie es sich zur ewigen Seligkeit verhält, d.h. ob es sich zu ihr verhält oder ob es sich nicht zu ihr verhält, ein Drittes gibt es nicht (tertium non datur) (unPB II 99).
Über das Individuum wäre überhaupt nichts auszusagen, meinte Platon, weil seine Einzelheit dem allgemeinen Begriff unzugänglich ist. Erkennbar sind demnach nur Formen (Ideen) – und empirische Gegenstände nur dann, wenn sie in eine Form gefasst werden können: individuum est ineffabile.
Auch das Mittelalter ist gegenüber dem Einzelnen skeptisch. Thomas stellt es in die logische Reihe von genus – species – individuum und hält „dieses da“ ist seiner konkreten Einzigartigkeit für nicht mitteilbar.
Von Aristoteles bis Kant erweist sich der Begriff „Individuum“ als Grenzbegriff, der Erkennbares von Unerkennbarem, Sagbares von Unsagbarem unterscheidet – als Begriff, nicht als reales Ding. Individuum ist demnach weder definierbar noch beweisbar, und daher auch kein Gegenstand der Metaphysik.
l.
Die Unmöglichkeit, ein Individuum zu sein, ist für Elfriede Jelinek eine geschlechtsspezifische. Mann ist Subjekt und verfügt über sich und die Frau, Frau wird verfügt (Janet Blanken, 1994).
kein mensch käme auf den gedanken dass gerda oder ingrid etwas zu sagen haben wenn sie den mund aufmachen. gerda und ingrid schweigen besser. das reden sollten sie jenen überlassen die es gelernt haben. und das sind eine ganze menge. wenn gerda oder ingrid versuchen wie im fernsehen oder im kino zu sprechen dann wissen sie gleich nicht weiter und müssen sich schämen. manchmal glauben gerda und ingrid dass es zwei verschiedene arten von sprache geben muss. diejenige die sie sprechen und diejenige die die andern sprechen. die andern vom fernsehen sind fast so anders wie der herr chef oder die junge frau patrizia. (Michael, Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft, 1972)
m.
Ganz anders sieht Kierkegaard das Individuelle begründet - oder verfehlt: Der Glaube ist nämlich dieses Paradox, dass der Einzelne höher steht als das Allgemeine (FZ 50) – man denke an den mittelalterlichen Diskurs zur Nichtmitteilbarkeit des Individuums – und das dadurch, dass der Einzelne ... sein Verhältnis zum Allgemeinen bestimmt durch sein Verhältnis zum Absoluten (FZ 64). Kierkegaard führt das beispielhaft an Abraham vor, der Isaak zu opfern bereit ist angesichts der absoluten Forderung, die ihn sprachlos macht vor Frau und Sohn, und die nicht vernünftig mitteilbar ist, oder an Tobias, der im Verhältnis mit dem Absoluten, mutig auf Saras Dämonen zutritt und sich ihnen aussetzt.
Gegenüber dem Allgemeinen, dem System, der Objektivität, sei gerade das Subjektive die eigentliche Qualität des Glaubens (besser: die eigentliche Glaubensdimension). Es ereigne sich im Wagnis, in der Entscheidung, in der Hingabe: Aber dann ist ja das Subjektivwerden, als ganz ausreichend (quantum satis) für ein Menschenleben, eine sehr preiswürdige Aufgabe. (unPB I 153)
Der Begriff des Handelns unterscheidet sich hier von dem Jelineks, die einen Bezug auf das Absolute nicht gelten lassen kann. Möglicherweise liegt aber gerade in ihrer marxistischen Position zwar die Möglichkeit der Kritik der bestehenden Verhältnisse, aber auch die Unmöglichkeit ihrer Überwindung. Sobald man weiß, wie ein Individuum existiert, weiß man auch, wie es sich zur ewigen Seligkeit verhält, d.h. ob es sich zu ihr verhält oder ob es sich nicht zu ihr verhält, ein Drittes gibt es nicht (tertium non datur) (unPB II 99).
weichensteller - 7. Jul, 08:00