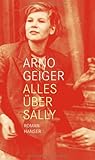I. Zur Raumerfahrung im Johannesevangelium
a.
Jesus geht im Kreis, als wäre er nervös, wäre angespannt, würde auf etwas warten, besorgt. Er geht auf und ab, wie im Wohnzimmer, an der Bushaltestelle oder im Büro. Die Säulenhalle des Salomo, Ort der Sammlung zum Gottesdienst, zum Gebet. Haben wir Jesus nervös gekannt, verärgert? Er wird im Gespräch mit Pharisäern angetroffen, ein unbefriedigendes Gespräch für beide Seiten. Provokant spricht Jesus von Hirten, von richtigen und falschen Hirten – nachdem ein Geheilter aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Von bezahlten Knechten. Und von Schafen, die auf den Hirten hören, die den wahren Hirten an der Stimme erkennen – und von noch anderen Schafen, die nicht von hier sind. Und von der Tür spricht er, vom Eingang in den Stall, vom Ausgang auf die Weide. Die Tür, die er ist, führt vom bergenden Innenraum in die Freiheit der Weide.
b.
Von der Säulenhalle des herodianischen Tempels schreibt Flavius Josephus, dass sie mit doppelten Säulenreihen den inneren Tempelbezirk umgeben hätten und so hoch gewesen wären, dass ein Besucher schwindlig würde, der vom zweiten Stock den Hügel hinab sah. Die königliche Säulenhalle – στοα βασιλικη - wäre dem Tempel im Süden vorgelagert gewesen, mit vier Säulenreihen. Die korinthischen Säulen seien aus weißem Marmor gewesen, das kassettenartige Gebälk aus Zedernholz, der Boden dazwischen aus bunten Steinen. Der innere Tempelbezirk sei abgetrennt gewesen, eine griechische und lateinische Inschrift habe Nichtjuden vor dem Betreten gewarnt. Die königliche Halle könnte ihre Bezeichnung wegen der besonderen Größe haben, oder weil der Thron Salomos dort gestanden sein könnte.
Der Evangelist wie auch Flavius Josephus schreiben beide in einer Zeit, da dieser Tempel nur noch Erinnerung war. Josephus erklärt dessen erhabene Ausmaße geradezu mit der Mühe, welche die Römer bei seiner Zerstörung hatten. (Abraham Schalit referiert und kommentiert Josephus wiederum aus der Distanz von zwei Jahrtausenden, im Vergleich mit der sich heute dort befindlichen „Omar-Moschee“)
c.
Von dieser Warte aus soll nun ein Blick auf das Johannesevangelium geworfen werden. Vom auf- und abgehenden Jesus, der seine Kreise zieht – und andere Kreise stört. In der Halle Salomons nun, wo sogleich der Anfang aufleuchtet: Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. (Joh 1) Die Königshalle, sein Eigentum? Der Tempel? Die Welt? Die Schöpfung? - Sein Kommen/ sein Gehen/ in-etwas-Sein/ was wem gehört: alle diese Fragen stecken in diesem Umhergehen und verweisen auf weiteres und anderes.
Das Auf- und Abgehen Jesu erscheint genau in er Mitte des Evangeliums (10,22f). Es ist Tempelweihfest, also die Erinnerung an die Wiedereinweihung des neu aufgebauten Tempels nach der Rückkehr aus dem Exil. Die eigentümliche Spannung, die in diesem Umhergehen liegt, könnte sich jederzeit entladen. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn: Wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, sag es uns offen! -
Da treten einander zwei Bewegungen entgegen, das Umhergehen und das Einkreisen. Jesu Bewegungsfreiheit erscheint eingeengt. Die Menge erträgt seine Ungebundenheit nicht und versucht, sich ihm in den Weg zu stellen. Sie will seinen Weg abkürzen, er soll gleich sagen, wo es lang geht. Doch die Antwort kommt nicht. Jesus kommt nicht auf den Punkt. Er verweist auf die Werke, und er weist die Fragenden zurück: Wer zu seinen Schafen gehört, folgt ihm, anstatt ihn einzukreisen. Und dann spricht Jesus von der Einheit: mit den Schafen, und mit dem Vater. Der Kreis zieht sich zusammen, es kommt beinahe zur Steinigung, doch Jesus entzog sich: ερχομαι – entkommen.
d.
Eine auffällige Bewegung war gleich zu Beginn zu sehen. Johannes und Jesus. Der Vorläufer und die Nachfolger. Die Jünger des Propheten folgen Jesus – still, unaufgefordert, aus eigenem Antrieb. Rabbi, wo wohnst du? – Komm und sieh. Von wem geht der Impuls aus? Johannes hatte auf ihn gezeigt, der stumm vorüber gegangen war. Hier der Prophet mit seinen Jüngern, der zu den Menschen spricht – dort der Vorbeigehende.
Es gab das bereits. Mose war der Prophet, der zu den Menschen sprach, der kündete von etwas Kommendem, Unerhörten. Der Schauplatz: Ägypten, Gefangenschaft, Sklavenexistenz. Der Vorbeigehende: der noch unbekannte, namenlose Gott, als rächender Engel, nachts, und er verschonte nur die zu ihm Gehörenden. Und noch einmal, später, am heiligen Berg: Mose in der Höhle, und hinter ihm der Vorbeiziehende, mit dem Namen offenbart, aber in der Wolke verborgen.
Dieser vorbeigehende Jesus ist ebenfalls dem Namen nach noch unbekannt. Johannes nennt ihn Lamm und spricht vom herabkommenden Geist. Aber dieser Vorbeigehende lässt sich ansprechen und einholen. Und man kann diesen Tag bei ihm bleiben – und länger. Die Frage nach Gott: wo? wird beantwortet mit Bleiben. Bei ihm bleiben. -
Aber sogleich zeigt sich: die Wo-Frage löst eine Kettenbewegung aus. Andreas – Simon – Philippus – Natanael unter dem Baum. Natanael, der Skeptische, wird von Jesus durch seine Verortung gewonnen: Du unter dem Feigenbaum (1,48). Ortswechsel – Wechsel der Zugehörigkeit.
e.
Jesus in Bewegung: er zog hinauf (ανεβη) nach Jerusalem, zum Paschafest, der Erinnerung und Wiederholung des verschonenden Vorbeigangs Gottes. Und im Tempel in heftiger Aktivität, Tische umstoßend, Händler, Geldwechsler und Opfertiere vertreibend. Mit ζηλος erklärt der Evangelist das – Jesus, ein Zelot? Ein Leidenschaftlicher, ein Kämpfender. Und dann kommt der Hinweis auf den Bau und den Abriss dieses Tempels, der sogleich wieder zurückführt in die Säulenhalle und das Tempelweihefest. Hier der Zornige, dort der Umhergehende, beide umringt von Verständnislosen. Hier ist es Jesus, der ihre Kreise stört: ihre Opfergottesdienste, ihre Geschäfte, ihre Rechthaberei vor Gott. Dort stört ihr Einkreisen sein unruhiges Umhergehen in der Halle.
Aber unser Blick auf diesen Tempel/Schauplatz sieht so wie der Blick des Evangelisten und auch des Josephus: dieser Tempel wird nicht mehr lange stehen. Zwar lässt der Evangelist Jesus seinen Tod und seine Auferstehung andeuten, aber Jesus hat nicht nur insgeheim, sondern auch wörtlich recht: die Tage des Tempels sind gezählt. Und dort wirft Jesus Tische um und geht umher.
f.
Eine weitere Fortbewegung, Kap. 5: Wieder geht Jesus hinauf (ανεβη) nach Jerusalem, betritt die Stadt durch das Schaftor, nimmt aber nicht den direkten Weg zum Tempel (links), sondern macht einen Umweg zum Teich Betesda (rechts). Unter vielen Kranken geht er auf einen zu und fragt ihn: Willst du gesund werden? Doch dieser scheint nicht zu verstehen, klagt über seine Beschwerlichkeit, überhört das Angebot, hebt den Blick nicht, bleibt in seinem Denken, das bis zum nächsten Aufguss reicht. Trotzdem heilt ihn Jesus, und dieser Mensch der kurzen Wege bis zum Beckenrand steigt von der Bahre und geht weg.
Und nun wird die Bedeutung des Sabbat sichtbar: Er schränkt die Wege ein. Jesus hält sich nicht an die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, und auch die von ihm Geheilten nicht. Jesus und der Geheilte treffen einander wieder im Tempel – sie sind also am selben Weg. Und auf die Sabbat-Kritik der Juden antwortet er geheimnisvoll: Mein Vater ist noch immer am Werk, und auch ich bin am Werk. (4, 17) Noch immer: Seit dem Exodus? Als Befreier? Jedenfalls ungehindert und unbeirrt, jedenfalls bewusst und absichtlich, und jedenfalls in Zusammenhang.
g.
Jesus am Berg: Ganz und gar nicht als Prediger – eher scheint es wie Freizeit, wenn er sich mit den Jüngern niederlassen will und von der Menge umringt findet. Es sind die, die seine Heilungen gesehen haben – damit ist ihre Umzingelung Jesu den Juden vergleichbar, die ihn wegen des Sabbat stellen wollten. Und wirklich, als er sie wundersam gespeist hatte, nannten sie ihn den erwarteten Propheten, er aber sah sich gewaltsam zum König gemacht. Die Bewegung? Nicht Nachfolge, sondern seine Verfügbarmachung durch die Menge, bereits in fortgeschrittenem Maße. –
Der zunehmenden Einengung Jesu entsprechen die Zeichen seiner unbeirrten Freiheit. In der Nacht geht er über den stürmischen See. – Und wenn hier einmal der Vergleich mit der synoptischen Überlieferung erlaubt ist, so ist dieser Gang Jesu im johannäischen Blick kein Majestätserweis, sondern ein Erweis seiner Bewegungsfreiheit. Von dieser Seite ergeht nun die Exodus-Erinnerung: Der seinen Weg über die Wasser nimmt, ist derselbe, der sich selbst zur Speise gibt: das Brot des Himmels.
h.
Die Verfolgung hat ein Maß erreicht, dass Jesus sein öffentliches Erscheinen einschränkt. Zum Laubhüttenfest schickt er die Jünger alleine – immer von ihm ausgehende Bewegung! um unerkannt und unabhängig dennoch selbst hinzugehen.
Da kommt es frühmorgens zu einem Ereignis. Während Jesus im Tempel lehrt, wird eine ertappte Ehebrecherin gebracht. Zu beachten ist die Szenerie: Der sitzende Jesus wird beim Lehren gestört. Die Frau wird in die Mitte gestellt. Die Schriftgelehrten und Pharisäer stehen im Kreis und wollen weniger sie als ihn verklagen. Wieder wird Jesus umringt. Wieder wird er gestört und beengt. Wieder bleibt er unbehelligt und ergreift die Initiative – zunächst, indem er nichts tut. Mit dem Finger auf die Erde schreiben – ist das Sammlung oder Zerstreuung? Erst auf ihre Zudringlichkeit hin antwortet er – nicht durch Verteidigung, sondern durch Umkehr der Schuldlast. Die Menge ist nicht im Recht, heißt das, die Menge, die das Verbot zu morden im Strafvollzug umgangen hat durch die Kollektivierung, wird wieder aufgelöst in einzelne Subjekte, die sich einzeln vor Gott zu rechtfertigen haben.
Jesus, der einzelne, besiegt die ihm feindliche Menge durch deren Rückführung in Einzelsubjekte, und bleibt mit der Frau alleine. Ein deutlicher Zug im Johannesevangelium, die Individualisierung: der Hauptmann, die Samariterin, der Geheilte, die Sünderin.
i.
Und nun: der geheilte Blinde. Zur Heilung wird er weggeschickt, um den Teig aus Erde und Speichel abzuwaschen. Eine Jesus-Berührung wie später bei Thomas, der auch zum Sehen kam? Aber die eigentliche Dramatik liegt im Unverständnis der Pharisäer, die ihn/ seine Eltern/ wieder ihn vorladen und befragen, in sichtlich gereizter Atmosphäre, und ihn schließlich aus der Gemeinde ausschließen. Dieses Hin/Wegbringen, das ist Jesu Bewegungsfreiheit entgegengesetzt, das ist der Versuch, einzureihen und Verfügung zu behalten/ zu erlangen. Dass der Blindgeborene den Pharisäern lieber war als der Sehende, ist offensichtlich. Und gerade dies sind die Zeichen seiner neuen Individualität: dass er sich gegen die Verfügung sperrt, dass er seiner Wahrnehmung treu bleibt, und dass er den Menschensohn erkennt. Und nun beginnt Jesus seine Reden vom guten Hirten, der seine Schafe kennt (individuell) und auf dessen Stimme sie hören.
Der bergende Raum? Die Freiheit der Weide?
Es geht um die Zugehörigkeit des einzelnen zu seinem Hirten, um die Nähe zu ihm – es ist die Antwort auf das Rabbi, wo wohnst du? Die Freiheit der Weide aber ist die Selbst-Bewegung: autopoiesis/Selbststeuerung statt Fremdsteuerung. Der erste Geheilte konnte selber gehen, anstatt sich von einem Aufguss zum nächsten dahinzuschleppen, auf den Boden fixiert, mit engem, vorgegebenen Handlungsradius. Der zweite Geheilte konnte wieder sehen, um zu entscheiden, wohin er gehört – und er hat gewählt. Zu seiner Selbsterkenntnis war der Ausschluss aus der Gemeinde geradezu nötig. – Angesichts der Hirt/Schafe-Metaphorik ist es eigentlich überraschend, dass Geheilte und Gläubige bei Joh immer einzelne sind. Die Jünger kommen als Gruppe kaum je ins Bild, nicht einmal beim letzten Abendmahl – eher sind sie stillschweigend vorausgesetztes Auditorium bei Jesu Reden und Heilungen – ja oft ist zwischen Monolog, Gebet und Unterweisung kaum zu unterscheiden – zu wem spricht er über den Vater?- hat er überhaupt laut gesprochen? Aber wenn das Kollektiv nur als misstrauische Menge und Zusammenrottung gezeigt wird, so treten dafür die Individuen in ihrer ganzen Ambivalenz auf: Schon bei Natanael konnten sein Schwanken/ seine Überraschung mitverfolgt werden, ebenso bei Nikodemus das Zögern. In Joh geht es nicht um gläubige Scharen, die Jesus hinterherlaufen, sondern um nachdenkliche, um Verständnis und Positionierung ringende Einzelpersonen. Das Individuum wird nicht durch Extravaganzen oder außergewöhnliche Biographien dargestellt, sondern durch sein Ringen um Entscheidung.
j.
Und diese Arbeit am richtigen Verhalten ist auch bei Jesus selbst zu sehen: Der Umweg nach Betesda, das Zeichnen am Boden, das Umhergehen im Tempel. Gewiss, Jesus handelt souverän. Aber das ist, weil er richtig entscheidet, weil er sein Erscheinen/ Verbergen unter Menschen so bemisst, dass er Menschen die Möglichkeit gibt, selbst zu erscheinen als Individuen: der Hochzeitsverantwortliche, die Samariterin, die einzelnen Jünger in der Berufungskette, die Sünderin. Auch Jesu Handeln ist ein ringendes, abwägendes, er beobachtet Situationen, schätzt Entwicklungen ein, provoziert seine Gegner und entzieht sich wieder ihrem Zugriff.
Und so ist der Raum im Johannesevangelium beim ersten Durchgang: Er schafft das Individuum durch seine (erkämpfte) Entscheidung – das könnte die Neugeburt sein, die Nikodemus nicht begreifen kann, das Eintreten in einen neuen Raum, wo Zugehörigkeit und Verhalten, Glaubensweisen und Verstehen nicht präformiert sind. Später wird derselbe – Lehrer zunächst, am Ende Lernender – diesen Jesus, der zwischen Säulen geht, der zwischen Klippen und Abstürzen geht, zwischen Felswände hinein betten, wo er zuletzt jeglicher Bewegungsfreiheit beraubt zu sein scheint, aber auch da noch nicht am Ende, noch nicht vollends hervorgetreten als das ganze Individuum: einen neuen Raum wird seine Bewegungsfreiheit schaffen, so wie Himmel und Erde entstanden sind, damit der Mensch Individuum sein kann.
Erst durch die Auferstehung kann der Mensch Individuum werden.
Jesus geht im Kreis, als wäre er nervös, wäre angespannt, würde auf etwas warten, besorgt. Er geht auf und ab, wie im Wohnzimmer, an der Bushaltestelle oder im Büro. Die Säulenhalle des Salomo, Ort der Sammlung zum Gottesdienst, zum Gebet. Haben wir Jesus nervös gekannt, verärgert? Er wird im Gespräch mit Pharisäern angetroffen, ein unbefriedigendes Gespräch für beide Seiten. Provokant spricht Jesus von Hirten, von richtigen und falschen Hirten – nachdem ein Geheilter aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Von bezahlten Knechten. Und von Schafen, die auf den Hirten hören, die den wahren Hirten an der Stimme erkennen – und von noch anderen Schafen, die nicht von hier sind. Und von der Tür spricht er, vom Eingang in den Stall, vom Ausgang auf die Weide. Die Tür, die er ist, führt vom bergenden Innenraum in die Freiheit der Weide.
b.
Von der Säulenhalle des herodianischen Tempels schreibt Flavius Josephus, dass sie mit doppelten Säulenreihen den inneren Tempelbezirk umgeben hätten und so hoch gewesen wären, dass ein Besucher schwindlig würde, der vom zweiten Stock den Hügel hinab sah. Die königliche Säulenhalle – στοα βασιλικη - wäre dem Tempel im Süden vorgelagert gewesen, mit vier Säulenreihen. Die korinthischen Säulen seien aus weißem Marmor gewesen, das kassettenartige Gebälk aus Zedernholz, der Boden dazwischen aus bunten Steinen. Der innere Tempelbezirk sei abgetrennt gewesen, eine griechische und lateinische Inschrift habe Nichtjuden vor dem Betreten gewarnt. Die königliche Halle könnte ihre Bezeichnung wegen der besonderen Größe haben, oder weil der Thron Salomos dort gestanden sein könnte.
Der Evangelist wie auch Flavius Josephus schreiben beide in einer Zeit, da dieser Tempel nur noch Erinnerung war. Josephus erklärt dessen erhabene Ausmaße geradezu mit der Mühe, welche die Römer bei seiner Zerstörung hatten. (Abraham Schalit referiert und kommentiert Josephus wiederum aus der Distanz von zwei Jahrtausenden, im Vergleich mit der sich heute dort befindlichen „Omar-Moschee“)
c.
Von dieser Warte aus soll nun ein Blick auf das Johannesevangelium geworfen werden. Vom auf- und abgehenden Jesus, der seine Kreise zieht – und andere Kreise stört. In der Halle Salomons nun, wo sogleich der Anfang aufleuchtet: Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. (Joh 1) Die Königshalle, sein Eigentum? Der Tempel? Die Welt? Die Schöpfung? - Sein Kommen/ sein Gehen/ in-etwas-Sein/ was wem gehört: alle diese Fragen stecken in diesem Umhergehen und verweisen auf weiteres und anderes.
Das Auf- und Abgehen Jesu erscheint genau in er Mitte des Evangeliums (10,22f). Es ist Tempelweihfest, also die Erinnerung an die Wiedereinweihung des neu aufgebauten Tempels nach der Rückkehr aus dem Exil. Die eigentümliche Spannung, die in diesem Umhergehen liegt, könnte sich jederzeit entladen. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn: Wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, sag es uns offen! -
Da treten einander zwei Bewegungen entgegen, das Umhergehen und das Einkreisen. Jesu Bewegungsfreiheit erscheint eingeengt. Die Menge erträgt seine Ungebundenheit nicht und versucht, sich ihm in den Weg zu stellen. Sie will seinen Weg abkürzen, er soll gleich sagen, wo es lang geht. Doch die Antwort kommt nicht. Jesus kommt nicht auf den Punkt. Er verweist auf die Werke, und er weist die Fragenden zurück: Wer zu seinen Schafen gehört, folgt ihm, anstatt ihn einzukreisen. Und dann spricht Jesus von der Einheit: mit den Schafen, und mit dem Vater. Der Kreis zieht sich zusammen, es kommt beinahe zur Steinigung, doch Jesus entzog sich: ερχομαι – entkommen.
d.
Eine auffällige Bewegung war gleich zu Beginn zu sehen. Johannes und Jesus. Der Vorläufer und die Nachfolger. Die Jünger des Propheten folgen Jesus – still, unaufgefordert, aus eigenem Antrieb. Rabbi, wo wohnst du? – Komm und sieh. Von wem geht der Impuls aus? Johannes hatte auf ihn gezeigt, der stumm vorüber gegangen war. Hier der Prophet mit seinen Jüngern, der zu den Menschen spricht – dort der Vorbeigehende.
Es gab das bereits. Mose war der Prophet, der zu den Menschen sprach, der kündete von etwas Kommendem, Unerhörten. Der Schauplatz: Ägypten, Gefangenschaft, Sklavenexistenz. Der Vorbeigehende: der noch unbekannte, namenlose Gott, als rächender Engel, nachts, und er verschonte nur die zu ihm Gehörenden. Und noch einmal, später, am heiligen Berg: Mose in der Höhle, und hinter ihm der Vorbeiziehende, mit dem Namen offenbart, aber in der Wolke verborgen.
Dieser vorbeigehende Jesus ist ebenfalls dem Namen nach noch unbekannt. Johannes nennt ihn Lamm und spricht vom herabkommenden Geist. Aber dieser Vorbeigehende lässt sich ansprechen und einholen. Und man kann diesen Tag bei ihm bleiben – und länger. Die Frage nach Gott: wo? wird beantwortet mit Bleiben. Bei ihm bleiben. -
Aber sogleich zeigt sich: die Wo-Frage löst eine Kettenbewegung aus. Andreas – Simon – Philippus – Natanael unter dem Baum. Natanael, der Skeptische, wird von Jesus durch seine Verortung gewonnen: Du unter dem Feigenbaum (1,48). Ortswechsel – Wechsel der Zugehörigkeit.
e.
Jesus in Bewegung: er zog hinauf (ανεβη) nach Jerusalem, zum Paschafest, der Erinnerung und Wiederholung des verschonenden Vorbeigangs Gottes. Und im Tempel in heftiger Aktivität, Tische umstoßend, Händler, Geldwechsler und Opfertiere vertreibend. Mit ζηλος erklärt der Evangelist das – Jesus, ein Zelot? Ein Leidenschaftlicher, ein Kämpfender. Und dann kommt der Hinweis auf den Bau und den Abriss dieses Tempels, der sogleich wieder zurückführt in die Säulenhalle und das Tempelweihefest. Hier der Zornige, dort der Umhergehende, beide umringt von Verständnislosen. Hier ist es Jesus, der ihre Kreise stört: ihre Opfergottesdienste, ihre Geschäfte, ihre Rechthaberei vor Gott. Dort stört ihr Einkreisen sein unruhiges Umhergehen in der Halle.
Aber unser Blick auf diesen Tempel/Schauplatz sieht so wie der Blick des Evangelisten und auch des Josephus: dieser Tempel wird nicht mehr lange stehen. Zwar lässt der Evangelist Jesus seinen Tod und seine Auferstehung andeuten, aber Jesus hat nicht nur insgeheim, sondern auch wörtlich recht: die Tage des Tempels sind gezählt. Und dort wirft Jesus Tische um und geht umher.
f.
Eine weitere Fortbewegung, Kap. 5: Wieder geht Jesus hinauf (ανεβη) nach Jerusalem, betritt die Stadt durch das Schaftor, nimmt aber nicht den direkten Weg zum Tempel (links), sondern macht einen Umweg zum Teich Betesda (rechts). Unter vielen Kranken geht er auf einen zu und fragt ihn: Willst du gesund werden? Doch dieser scheint nicht zu verstehen, klagt über seine Beschwerlichkeit, überhört das Angebot, hebt den Blick nicht, bleibt in seinem Denken, das bis zum nächsten Aufguss reicht. Trotzdem heilt ihn Jesus, und dieser Mensch der kurzen Wege bis zum Beckenrand steigt von der Bahre und geht weg.
Und nun wird die Bedeutung des Sabbat sichtbar: Er schränkt die Wege ein. Jesus hält sich nicht an die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, und auch die von ihm Geheilten nicht. Jesus und der Geheilte treffen einander wieder im Tempel – sie sind also am selben Weg. Und auf die Sabbat-Kritik der Juden antwortet er geheimnisvoll: Mein Vater ist noch immer am Werk, und auch ich bin am Werk. (4, 17) Noch immer: Seit dem Exodus? Als Befreier? Jedenfalls ungehindert und unbeirrt, jedenfalls bewusst und absichtlich, und jedenfalls in Zusammenhang.
g.
Jesus am Berg: Ganz und gar nicht als Prediger – eher scheint es wie Freizeit, wenn er sich mit den Jüngern niederlassen will und von der Menge umringt findet. Es sind die, die seine Heilungen gesehen haben – damit ist ihre Umzingelung Jesu den Juden vergleichbar, die ihn wegen des Sabbat stellen wollten. Und wirklich, als er sie wundersam gespeist hatte, nannten sie ihn den erwarteten Propheten, er aber sah sich gewaltsam zum König gemacht. Die Bewegung? Nicht Nachfolge, sondern seine Verfügbarmachung durch die Menge, bereits in fortgeschrittenem Maße. –
Der zunehmenden Einengung Jesu entsprechen die Zeichen seiner unbeirrten Freiheit. In der Nacht geht er über den stürmischen See. – Und wenn hier einmal der Vergleich mit der synoptischen Überlieferung erlaubt ist, so ist dieser Gang Jesu im johannäischen Blick kein Majestätserweis, sondern ein Erweis seiner Bewegungsfreiheit. Von dieser Seite ergeht nun die Exodus-Erinnerung: Der seinen Weg über die Wasser nimmt, ist derselbe, der sich selbst zur Speise gibt: das Brot des Himmels.
h.
Die Verfolgung hat ein Maß erreicht, dass Jesus sein öffentliches Erscheinen einschränkt. Zum Laubhüttenfest schickt er die Jünger alleine – immer von ihm ausgehende Bewegung! um unerkannt und unabhängig dennoch selbst hinzugehen.
Da kommt es frühmorgens zu einem Ereignis. Während Jesus im Tempel lehrt, wird eine ertappte Ehebrecherin gebracht. Zu beachten ist die Szenerie: Der sitzende Jesus wird beim Lehren gestört. Die Frau wird in die Mitte gestellt. Die Schriftgelehrten und Pharisäer stehen im Kreis und wollen weniger sie als ihn verklagen. Wieder wird Jesus umringt. Wieder wird er gestört und beengt. Wieder bleibt er unbehelligt und ergreift die Initiative – zunächst, indem er nichts tut. Mit dem Finger auf die Erde schreiben – ist das Sammlung oder Zerstreuung? Erst auf ihre Zudringlichkeit hin antwortet er – nicht durch Verteidigung, sondern durch Umkehr der Schuldlast. Die Menge ist nicht im Recht, heißt das, die Menge, die das Verbot zu morden im Strafvollzug umgangen hat durch die Kollektivierung, wird wieder aufgelöst in einzelne Subjekte, die sich einzeln vor Gott zu rechtfertigen haben.
Jesus, der einzelne, besiegt die ihm feindliche Menge durch deren Rückführung in Einzelsubjekte, und bleibt mit der Frau alleine. Ein deutlicher Zug im Johannesevangelium, die Individualisierung: der Hauptmann, die Samariterin, der Geheilte, die Sünderin.
i.
Und nun: der geheilte Blinde. Zur Heilung wird er weggeschickt, um den Teig aus Erde und Speichel abzuwaschen. Eine Jesus-Berührung wie später bei Thomas, der auch zum Sehen kam? Aber die eigentliche Dramatik liegt im Unverständnis der Pharisäer, die ihn/ seine Eltern/ wieder ihn vorladen und befragen, in sichtlich gereizter Atmosphäre, und ihn schließlich aus der Gemeinde ausschließen. Dieses Hin/Wegbringen, das ist Jesu Bewegungsfreiheit entgegengesetzt, das ist der Versuch, einzureihen und Verfügung zu behalten/ zu erlangen. Dass der Blindgeborene den Pharisäern lieber war als der Sehende, ist offensichtlich. Und gerade dies sind die Zeichen seiner neuen Individualität: dass er sich gegen die Verfügung sperrt, dass er seiner Wahrnehmung treu bleibt, und dass er den Menschensohn erkennt. Und nun beginnt Jesus seine Reden vom guten Hirten, der seine Schafe kennt (individuell) und auf dessen Stimme sie hören.
Der bergende Raum? Die Freiheit der Weide?
Es geht um die Zugehörigkeit des einzelnen zu seinem Hirten, um die Nähe zu ihm – es ist die Antwort auf das Rabbi, wo wohnst du? Die Freiheit der Weide aber ist die Selbst-Bewegung: autopoiesis/Selbststeuerung statt Fremdsteuerung. Der erste Geheilte konnte selber gehen, anstatt sich von einem Aufguss zum nächsten dahinzuschleppen, auf den Boden fixiert, mit engem, vorgegebenen Handlungsradius. Der zweite Geheilte konnte wieder sehen, um zu entscheiden, wohin er gehört – und er hat gewählt. Zu seiner Selbsterkenntnis war der Ausschluss aus der Gemeinde geradezu nötig. – Angesichts der Hirt/Schafe-Metaphorik ist es eigentlich überraschend, dass Geheilte und Gläubige bei Joh immer einzelne sind. Die Jünger kommen als Gruppe kaum je ins Bild, nicht einmal beim letzten Abendmahl – eher sind sie stillschweigend vorausgesetztes Auditorium bei Jesu Reden und Heilungen – ja oft ist zwischen Monolog, Gebet und Unterweisung kaum zu unterscheiden – zu wem spricht er über den Vater?- hat er überhaupt laut gesprochen? Aber wenn das Kollektiv nur als misstrauische Menge und Zusammenrottung gezeigt wird, so treten dafür die Individuen in ihrer ganzen Ambivalenz auf: Schon bei Natanael konnten sein Schwanken/ seine Überraschung mitverfolgt werden, ebenso bei Nikodemus das Zögern. In Joh geht es nicht um gläubige Scharen, die Jesus hinterherlaufen, sondern um nachdenkliche, um Verständnis und Positionierung ringende Einzelpersonen. Das Individuum wird nicht durch Extravaganzen oder außergewöhnliche Biographien dargestellt, sondern durch sein Ringen um Entscheidung.
j.
Und diese Arbeit am richtigen Verhalten ist auch bei Jesus selbst zu sehen: Der Umweg nach Betesda, das Zeichnen am Boden, das Umhergehen im Tempel. Gewiss, Jesus handelt souverän. Aber das ist, weil er richtig entscheidet, weil er sein Erscheinen/ Verbergen unter Menschen so bemisst, dass er Menschen die Möglichkeit gibt, selbst zu erscheinen als Individuen: der Hochzeitsverantwortliche, die Samariterin, die einzelnen Jünger in der Berufungskette, die Sünderin. Auch Jesu Handeln ist ein ringendes, abwägendes, er beobachtet Situationen, schätzt Entwicklungen ein, provoziert seine Gegner und entzieht sich wieder ihrem Zugriff.
Und so ist der Raum im Johannesevangelium beim ersten Durchgang: Er schafft das Individuum durch seine (erkämpfte) Entscheidung – das könnte die Neugeburt sein, die Nikodemus nicht begreifen kann, das Eintreten in einen neuen Raum, wo Zugehörigkeit und Verhalten, Glaubensweisen und Verstehen nicht präformiert sind. Später wird derselbe – Lehrer zunächst, am Ende Lernender – diesen Jesus, der zwischen Säulen geht, der zwischen Klippen und Abstürzen geht, zwischen Felswände hinein betten, wo er zuletzt jeglicher Bewegungsfreiheit beraubt zu sein scheint, aber auch da noch nicht am Ende, noch nicht vollends hervorgetreten als das ganze Individuum: einen neuen Raum wird seine Bewegungsfreiheit schaffen, so wie Himmel und Erde entstanden sind, damit der Mensch Individuum sein kann.
Erst durch die Auferstehung kann der Mensch Individuum werden.
weichensteller - 7. Jul, 08:30