Ich stelle hier ein Lesen vor,
das Sie überraschen wird, ein Lesen, das im ursprünglichen Sinn ein Sammeln ist. Gleich vier Bücher lesen, die miteinander zunächst gar nichts zu tun haben, keine Verbindung der Autoren, keine gemeinsame Poetologie, keine gleichen Themen. Aber auch jedes dieser Bücher soll schichtweise gelesen werden, als Gebäude mit Stockwerken, zwischen denen gewechselt werden kann. In jedem der Bücher sind unter der Hand andere Texte mitgeschrieben, von fremden, manchmal unbekannten Autoren, und es ist nicht sicher, ob das immer absichtlich geschehen ist beim Schreiben, oder ob sich die Bezugstexte auch von selbst mitschreiben.
Ich beginne mit dem jüngsten Text, 1999 veröffentlicht, Allerseelen von Cees Nooteboom. Eine Geschichte, die vorwiegend in Berlin spielt, mit einem kleinen Abstecher nach Holland und einem Anhang in Spanien. Im wesentlichen sind es Streifzüge durch die winterliche Stadt, von einem Sonderling, Dokumentarfilmer, der die Familie verloren hat. Es gibt Begegnungen mit einigen Freunden, Gespräche, Erinnerungen, einige kulinarische Zusammentreffen eines Freundeskreises. Dann eine Bekanntschaft mit einer jungen Frau, Studentin, kurz und intensiv, mit einer längeren, unbefriedigenden Nachgeschichte.
Mag sein, dass der Plot dürr ist für ein großes Buch. Das könnte ein Hinterhalt sein. Ganz bestimmt verführen die Sinne den Leser, die Stadt im Schnee, die Orte, die man kennt, die Speisen, die kredenzt werden, die Stimmen, die Sehnsüchte, die seltsam verhaltene Begegnung mit der Studentin.
Ich rate, zum Einstieg unter die Oberfläche die Abstiege zu verfolgen. Er las die Stadt wie ein Buch, eine Geschichte über unsichtbare, in der Historie verschwundene Gebäude, Folterkammern der Gestapo, die Stelle, an der Hitlers Flugzeug noch hätte landen können, alles erzählt in einem kontinuierlichen, fast skandierten Rezitativ. (23)
Die zweite, miterzählte Geschichte ist also die Geschichte, das Rezitativ. Erzähler dieser zweiten Geschichte ist die Stadt selbst, gelesen wird sie vom Freund Viktor, der sie Arthur Daane vorbuchstabiert. Aber alle Figuren scheinen ein Verhältnis zu dieser zweiten Geschichte zu haben, und bereits Arthurs Betreten der Stadt verläuft so:
Die alte Frau blieb oben an der Treppe stehen. Von unten klang das Gewitter der U-Bahn herauf. Arthur steigt in die Unterwelt hinab wie Orpheus zu den Toten (über den er reflektiert). Sie ging weg, drehte sich um und sagte: „Alles Unsinn.“ Dabei lachte sie, und einen kurzen Moment lang, so flüchtig, dass man ihn mit keiner Kamera hätte einfangen können, hatte sie das Gesicht, das sie einst, in irgendeinem Augenblick ihres Lebens, schon einmal gehabt haben musste. ... Die meisten Lebenden waren genauso unerreichbar wie die Toten. (46f) Arthur ist im Totenreich unterwegs, von Eurydike hinuntergelockt, und erforscht Berlin von unten. Dachau, Napoleon in Moskau, nach Frankreich zogen zwei Grenadier´, Stalingrad, von Paulus sind Erscheinungen jener Welt und verkörpern ihr Grauen. Das Totenreich führt Arthur in die Vergangenheit, ihn umgibt das fortgesetzte Flüstern der Toten unter jeder Gasse Berlins. Er steigt die Treppen zur Unterwelt hinunter und findet seine Familie: „Soll ich dir einen Vater und eine Mutter aussuchen?“(66), fragt er seine (unnahbare) Begleiterin, die verlorene Frau mit dem Sohn.
Das Gemälde im Schloss, Königin Luise von Preußen, ein weiterer Einstieg: Sie hatte nicht nur eine unverkennbare sexuelle Ausstrahlung, sondern es schien auch so, als wollte die Frau aus dem Bild heraus, als ertrage sie den Rahmen nicht. Eurydike wartet auf die Erlösung. Aber es könnte sein, wird angedeutet, dass sie ihren Orpheus nicht mehr erkennt. Solche Frauen gibt es nicht mehr. ... Dieser Blick ist ausgestorben. (54) Die Vergangenheit drängt in die Gegenwart herein, aber sie kommt nicht zu sich. Auf diese Weise befinden wir uns ständig im Totenreich. ... Ein immerwährendes Gespräch an ein und derselben Stelle. (107) Unerlöste Vergangenheit, unerlöste Toten, unerhörte Worte und Sätze, ein Gebrummel, Gemurmel. Unerkannt drohen ihre Geschicke zu bleiben. Das Unverständnis und die Dumpfheit gegenüber ihrem Bedeutungsüberschuss sind aus der Gegenwart genügend bekannt.

Arthur befindet sich am Ort der Produktion von Wirklichkeit, von Daten und Fakten. Der Redakteur öffnete die Tür zu einem Saal voll schweigender Gestalten an Computern. Lieber tot, er wusste später noch, dass er das gedachte hatte. (25) Von dieser Erscheinung von Wirklichkeit aus der Unterwelt hebt sich Arthur fortgesetzt ab mit seinen wesenhaften Dokumentarfilmen. Sein großes Projekt ist das Einsammeln von Authentizität, beruflich von Tod und Abgeschiedenheit, als persönliche Leidenschaft von Metaphern für das Leben: alles durch Filmaufnahmen, die Gewesenes retten, damit kein Gestus ausstirbt wie das Lächeln der Königin. Hier haben Sie wieder das Lesen, es ist als wesenhaftes Lesen klar markiert durch das Unzeitgemäße und Unangepasste. Am liebsten wäre es ihnen, glaube ich, wenn sie gar nicht mehr existierte (26), sieht Arthur die Welt in ihrer Existenz gefährdet und kämpft um sie.
Die Stadt als Buch erzählt von der Unterwelt und damit von der Vergangenheit. Auf diese Weise befinden wir uns ständig im Totenreich. (107) Das Buch ist offen nach unten und nach hinten, das ergibt die erste (grobe) Vermessung.
Im Zentrum der Erzählung ist eine scharfsinnige Tischrunde (122). Die Ritter der Tafelrunde treten aus dem Totenreich und kommen zu üppigen Mahlen zusammen. Zum Ensemble gehört der Wirt Schulze sowie Galinsky, der Tote: Er sitzt so still wie eine Statue .... als ob er in der Ferne Musik hörte. (122f) Arno, Viktor, Zenobia: Arthur lehnte sich zurück. Vielleicht, dachte er, ist das ja der Grund, warum ich immer wieder nach Berlin zurückkehre. Ein Kreis, in den er aufgenommen war (115). Von diesem Kreis gab es im Schloss ein Bild:

Es handelt sich um ein Gemälde Adolph von Menzels, das Friedrich den Großen neben Voltaire zeigt, im Kreis führender Köpfe der Preußischen Akademie der Wissenschaften, im Schloss Sanssouci. Das Bild entstand 1850 und verbrannte 1945. Es dokumentiert den Gestus des Königs, die Weisen seiner Zeit, Diplomaten, Schriftsteller und Offiziere von Rang zu versammeln und unter ihnen der Philosoph von Sanssouci zu sein.
Es ist eine Treppe, auf der in Fontanes Gedicht der Dichter und Spaziergänger dem König begegnet und angesprochen wird auf den Maler Menzel, welcher bei der Tafelrunde Voltaires Platz einnehmen soll (Theodor Fontane, Auf der Treppe von Sanssouci). Und so pflanzt die Runde sich fort. Denn auch der König war mit Bau und Einrichtung von Schloss Sanssouci eingestiegen in ein bereits seit dem Mittelalter währendes Tafeln, als König Arthur die Tapferen seiner Zeit an den Hof holte und sie auf gleicher Höhe um den Gral versammelte. Ihre Erzählungen gehören zu den großen Texten des Mittelalters – die sich somit auch in diesem Buch fortschreiben.
Die Runde verweist auf das Mittelalter; das Mahl selbst hingegen ist die Zusammenkunft derer, die von ihren Taten und Überlegungen zu erzählen haben – und ist somit selbst wiederum sprachliche Ereignisstätte von Vergangenheit. Nicht nur die Stadt selbst, deren Oberfläche und Gegenwart vom Schnee verdeckt wird, versinkt in der Vergangenheit, auch das Hauptereignis, das Tafeln, wächst auf mittelalterlichem Boden.
Das dritte Fenster in die Vergangenheit ist Elik Oranje. Die geheimnisvolle Studentin mit dem Königsnamen, die auf eigene Faust nach der mittelalterlichen Königin forscht, erscheint selbst wie deren Inkarnation. Ihre Weltfremdheit, ihr Einzelgängertum und ihre stumme Sexualität sind Marken dafür, und einzig eine Großmutter scheint Zeugin der wirklichen welthaften Existenz dieses Wesens zu sein, dessen Herkunft ansonsten nur eine erzählte ist – und somit der legendären Königin entsprechend. Immerhin scheint sie für Arthur doch sehr wirklich zu werden: Sie tritt ein in den Kreis der Tafelnden und behauptet sich dort mit der Sprache; sie tritt Arthur – wenn das gesagt werden kann – nahe, wobei die Nähe entschieden wird und sich nicht aus dem Beziehungsverlauf ergibt. Die beiden scheinen sich durch einander jeweils erlösen zu wollen von einem Bann: sie von der Narbe ihrer Herkunft, er von der Narbe seines Verlustes von Frau, Kind und Heimat.
Diese Art des Lesens, das im Text andere Texte aufspürt, kann aber nicht alles entscheiden und abschließen. Offen bleibt etwa die Rückfrage nach Odysseus, dem Held Arthurs Jugendzeit, oder nach Orpheus, der seine Frau aus der Unterwelt erlösen will, der ebenfalls genannt wird. Beide auf schwieriger Fahrt, auf eine Frau zu. Der eine ringt mit Zyklopen (88), der andere begegnet Schatten. Der eine, der Tatkräftige, findet und befreit sie, der andere, der Sänger, verfehlt sie. Jedenfalls ein Reisender ohne Gepäck (11), Arthur, der mit Ungeheuern zu tun hat und mit Toten. Aber das ist noch nicht alles, was ich sehe. Es ließe sich noch etwas sagen über den Horizont dieser Reise.
Was uns immer wieder wundert, ist, dass ihr euch so wenig wundert. (64) So hebt ein Metadiskurs an, der das erzählte Geschehen von oben und außerhalb kommentiert. Er nennt sich selbst, ganz nach antikem Vorbild, der Chor. Der Chor der Engel begleitet die Menschengeschichte und wundert sich darüber. Er hat die Menschheit im Ganzen im Blick, Zeit und Raum, Ewigkeit, Gott, Geschichte – und das Verhalten der Menschen darin. Die Wesen, die sich nur die Begleitung nennen und nicht selbst richtig leben dürften (64), sind schon bei Peter Handke und Wim Wenders im Himmel über Berlin (1987) zuhause. Ihr erster Kommentar hinsichtlich der menschlichen Vergänglichkeit: Es ist, als explodierte die Zeit hinter euch in einem fort. (65) Das sind, vom Himmel, vom Jenseits aus gesehen, schlechte Vorzeichen für eine Rekonstruktion der Vergangenheit. Die schlafende Elik möchte mit der Hand die Wahrheit aus dem Buch ziehen wie einen Körper, wie die vergangene Zeit und die ferne Königin, wie eine Ausgrabung, aber ihr könntet nicht damit umgehen (206), sagen die Engel. Ein Licht der Vergeblichkeit, in dem die Handlung erscheint. Vergeblich, sich den Toten zu nähern. Also Orpheus. Umsonst, die Heldentaten. Doch Odysseus? Die wissenden Engel staunen selbst über den Menschen: wie schlecht ihr in euer eigenes Dasein paßt. (64) Immerhin wird es zum Rätsel erhoben, wie weit der Geist des Menschen geht und wie viel Raum er einnehmen kann.
Der Horizont des Himmels überspannt auch die Unterwelt. Orpheus sinniert über die Toten: Er war hier, aber sie waren allgegenwärtig, sie hatten keinen Ort mehr und waren überall, sie hatten keine Zeit mehr und waren immer da. (147) Seine gestorbene Frau, die nie ganz von dieser Welt war (149), hat ihm somit eigentlich den Horizont gewiesen, in den Worten des Johannesprologs. Sucht er nun die Welt oder den Himmel, wenn er Völker besucht, die eine Schöpfung hatten, die für sie allein geschaffen war und deren Schritte über trockene leere Landschaften er filmt. Als er sich trotz Warnung nachts allein aus der Stadt wagt, überfällt ihn das Nichts, die totale Stille: so war der Himmel auf ihn gefallen (154), und darin waren drei Gestalten erschienen, die aus der Tiefe von Jahrtausenden gekommen waren. Er hatte ohne Angst bestanden, weil er nicht in diese Welt gehörte (155) und, wie die Engel sagen würden, schlecht in sein Dasein passt. Denn die ganze Welt war ein Verweis, alles verwies auf etwas anderes zurück (156) Auf die Geschichte, das Gewordene. Der Mönchsgesang ist das Röcheln der Ewigkeit. (200). Gleichwie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt (282f), liest man in Kohelet. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war (283) , wird Psalm 139 gelesen, die größte erreichte Weite, die weiteste Offenheit nach vor und zurück und aus der Zeit heraus, im Zitat zwar und nicht im Bekenntnis, aber wie kann Sprache weiter aus der Welt hinausweisen als im Zitat, zumal eines Lehrers für einen Suchenden und Fragenden. Zenobias Leidenschaft für Raumfahrt können diesen Horizont nicht ausfüllen, und Arthurs Abenteuerfahrt hinter der Erscheinung der Königin her wohl auch nicht, obwohl beide in gewisser Weise die Grenzen der Schöpfung durchmessen im Wagnis. Die Geschichte, die mit einem Vorübergang an der Buchhandlung und somit mit dem Lesen begonnen hatte, läuft auf den sichtbar werdenden hohen Himmel des Nordens zu, eine Durchquerung der Schöpfung in allen Richtungen von Raum und Zeit.
Handke war schon am Wort – das zweite Buch soll Langsame Heimkehr sein, ebenfalls eine Reisegeschichte, und mehr als die vorige, und zugleich, so sei es gleich voraus gesagt, eine innere Reise durch die Schöpfung. Mit den gewonnenen Wegmarken lassen sich die Etappen leichter abstecken. Sorger, der Geologe und Naturforscher – Schöpfungsforscher, möchte man beinahe sagen – untersucht über Jahre eine Flusslandschaft im hohen Norden Kanadas, wo im Verborgenen die Schotterkugeln dahinglitten, sich rollend überschlugen oder sogar langsame Bogensprünge vollführten, eingehüllt in Schlammwolken und weiterbefördert von natürlichen Wasserwalzen, welche – tief unter der stillen Oberfläche in der Gegenrichtung rotierend – er sich nicht denken, sondern sinnlich miterleben konnte (12f). Er hat ein Gespür für die Formen unter der Oberfläche, für die Wellen und Kurven, die Hebungen und Senkungen, für die räumliche Tiefe, möchte man sagen, und auch für die zeitliche, in jahreszeitlichen und erdgeschichtlichen Skalen.
Der Name Sorger? Der Forscher geriert sich nicht als objektiver, unbeteiligter Beobachter, sondern sieht seinen Auftrag darin, seine Anstrengung, das Befremdende jeder Erdgegend auszuhalten (16) – es ist eine Weltvertrauens-Übung, ein Teilhaftigwerden an „seinem Gegenstand“ (17). Der Sorgende ist Teilnehmer, Mitbetroffener, Vollzieher der Natur in ihren Dimensionen: Raum und Zeit konstatiert er wörtlich mit (in) seiner Existenz, über Jahre in der Tundra. Aber nicht nur das: In diesem Zeitraum war ständige Gegenwart, ständige Allerwelt, ständige Bewohntheit. Die Gegenwart war eine Allgegenwart, wo die einst geliebten Toten mitatmeten (52). So ist bereits mit wenigen Strichen ein Schauplatz gezeichnet, der, nunmehr in der wilden Natur, ebenso wie vorhin in Berlin den Untergrund, das Gewordene und Gewesene aufleuchten lässt, bewohnte Schöpfung. Die Indianerfrau, die Katze, der Kollege Lauffer, das Dorf: alles Erscheinungen des Grundes, ließe sich sagen, wie die plötzlich erschienenen Aborigines am nächtlichen Rand Alice Springs, als Arthur die Stille des Nichts erfahren hatte: Epiphanien des Grundes. (Ich könnte weitere anführen, aus dem nächsten und übernächsten Text, vielleicht komme ich dazu.)
Von dort reist Sorger ohne genannten Grund ab, über mehrere Stationen nach Europa, eben die langsame Heimkehr. Die nächste Station an der Pazifikküste bringt eine Veränderung seiner Naturwahrnehmung. Zunächst durchstreift er die Dünenlandschaft, er, der auf den Grund gesehen hat und von dort seine Sprache bekommen hat (104) – aber fern von der Schöpfung (130) erfahrt er eine Versagung der Lebendigkeit und Zugänglichkeit der Natur: Eine Maschine empfing ständig die Tonwellen aus dem Erdinneren, ... ein ... fast singender Klang (131). Eine Versagung auch von Menschen, die ihn nicht erkennen: Dann wurde der Boden zu seinen Füßen so deutlich, als sei er schon gestürzt. (137) Und in der hereinbrechenden Einsamkeit überwältigt ihn eine unbekannte Unbehaustheit: Das Meer wurde unheimlich. – Zerstört war der Lebensplan .... aus dem Untergrund fuhr „der lebende Tote“ in ihn .... und er sah...die Seele ... hatte Sorger ein Erdbeben erlebt .... so schien ihm jetzt auch das eigene Ende ganz nah .... die Weltenrichterstimme ..... „Danke, ihr Mächte.“ .... „Göttlicher anderer.“ .... Erlebnis der „Schwelle“: wieder im Spiel der Welt sein. (137-141) In dieser erdbebenreichen Küstenlandschaft wird mit Naturmetaphern eine Grunderfahrung erzählt: der Existenzgrund, im ganzen Buch stets unterschwellig gegenwärtig, wird erschüttert, ohne erkennbaren Anlass, ein Ereignis in aller Stille und Einsamkeit. Dieser zweite Abschnitt der Heimkehr heißt Raumverbot – der Naturraum/Weltraum hat sich in seiner Bedeutungskraft entzogen.
Der dritte Abschnitt heisst Das Gesetz. In Abweichung von seinem Plan bleibt Sorger an einem Ort, wo er jemanden kennt. Ihn will der Einsame besuchen, und erfährt gerade von seinem Tod. Vor dem Sarg beweint er den Toten und die anderen Toten. Aufschauend glaubte er zu sehen, wie diese gewaltig über ihn lachten. Er lachte mit ihnen. (166) Diese Begegnung mit dem Tod/Toten führt Sorger neu in eine Behaustheit zurück, der sogleich in der Schneelandschaft in einer schimmernden Furche: die schönste Frau, die er je gesehen hatte, erblickt und somit seinen Naturalismus wieder hat. Was hat sich geändert? Er sieht die Inbilder seiner Verstorbenen, es zieht ihn zu den Abgeschiedenen hin, er gelangt in ein Neubegreifen der Zeit, stellt sich die Zeit als einen „Gott“ vor, der „gut“ war. (173) Gerade in der Großstadt, seiner letzten Station, findet er wieder zum Bewußtsein „seiner“ Erdformen zurück (179). Es ist die Sorge um einen Menschen, der sich ihm anvertraut, die ihm einen Tag in der großen Stadt schenkt, wo er aus dem tiefen Nacht-Raum wie von einem Schauder der Schöpfung überflogen wird (183). Er sieht in einer Vision die Große Handschrift, in der sein Leben beschrieben wurde (201), das als Begegnung der Elemente (Spiegel, Nichts und Gravität) gesehen wird. Diese apokalyptische Vision zeigt, dass die Geschichte der Menschheit bald vollendet sein würde (209), und führt Sorger in eine Sonntagsmesse, wo er gewahr wird, wie ein Schwanken durch die Welt geht, während Brot und Wein gewandelt werden: in ähnlicher Weise (206), also gewandelt, streift er wieder durch die Straßen, vorbei an Bekannten und Unbekannten, und ein Schulfreund erkennt den Gewandelten und erkennt ihn nicht: „Wie der Valentin Sorger!“
Die Welt/die Schöpfung ist wieder zum bergenden Haus geworden, weniger durch einen Persongott, eher durch eine pantheistische Natur. Die Dimensionen der Schöpfung verlaufen im Untergrund, in den geologischen Formen und Abläufen, in der Totenwelt, in Schuld und Gutsein – und zuletzt in einer Art geschenkter (gnadenhafter) Identität. Freies Handeln (Subjektivität) und Gefühl der Eingebundenheit (Gnade) sind verflochten und nicht entwirrbar. Was bei Nooteboom Literaturzitat, ist bei Hanke sozusagen Naturzitat – bedeutungsüberschießend beide. Schöpfungsmetaphern des Werdens und Vergehens, des Ereignishaften, das innerweltlich rätselhaft bleibt und zur Deutung eine externe Perspektive braucht, je in vertikaler Dimension, von Engeln und Toten.
Mehr noch als für die bisherigen Texte gilt das für den dritten: Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien, unter besonderer Beachtung der neunten, und mit einer gewissen Neugier für die Sonette an Orpheus im Hinblick auf das erste besprochene Buch, welche sich im selben Band befinden.
(Der vierte und letzte Text dieses Gevierts wird Robert Musils 4.Kapitel Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch Möglichkeitssinn geben aus Der Mann ohne Eigenschaften sein. Mit diesen vieren ließe sich ein Schöpfungsverständnis umreißen, das, so meine ich, auf der Höhe unserer Zeit sein könne.)

Ich beginne mit dem jüngsten Text, 1999 veröffentlicht, Allerseelen von Cees Nooteboom. Eine Geschichte, die vorwiegend in Berlin spielt, mit einem kleinen Abstecher nach Holland und einem Anhang in Spanien. Im wesentlichen sind es Streifzüge durch die winterliche Stadt, von einem Sonderling, Dokumentarfilmer, der die Familie verloren hat. Es gibt Begegnungen mit einigen Freunden, Gespräche, Erinnerungen, einige kulinarische Zusammentreffen eines Freundeskreises. Dann eine Bekanntschaft mit einer jungen Frau, Studentin, kurz und intensiv, mit einer längeren, unbefriedigenden Nachgeschichte.
Mag sein, dass der Plot dürr ist für ein großes Buch. Das könnte ein Hinterhalt sein. Ganz bestimmt verführen die Sinne den Leser, die Stadt im Schnee, die Orte, die man kennt, die Speisen, die kredenzt werden, die Stimmen, die Sehnsüchte, die seltsam verhaltene Begegnung mit der Studentin.
Ich rate, zum Einstieg unter die Oberfläche die Abstiege zu verfolgen. Er las die Stadt wie ein Buch, eine Geschichte über unsichtbare, in der Historie verschwundene Gebäude, Folterkammern der Gestapo, die Stelle, an der Hitlers Flugzeug noch hätte landen können, alles erzählt in einem kontinuierlichen, fast skandierten Rezitativ. (23)
Die zweite, miterzählte Geschichte ist also die Geschichte, das Rezitativ. Erzähler dieser zweiten Geschichte ist die Stadt selbst, gelesen wird sie vom Freund Viktor, der sie Arthur Daane vorbuchstabiert. Aber alle Figuren scheinen ein Verhältnis zu dieser zweiten Geschichte zu haben, und bereits Arthurs Betreten der Stadt verläuft so:
Die alte Frau blieb oben an der Treppe stehen. Von unten klang das Gewitter der U-Bahn herauf. Arthur steigt in die Unterwelt hinab wie Orpheus zu den Toten (über den er reflektiert). Sie ging weg, drehte sich um und sagte: „Alles Unsinn.“ Dabei lachte sie, und einen kurzen Moment lang, so flüchtig, dass man ihn mit keiner Kamera hätte einfangen können, hatte sie das Gesicht, das sie einst, in irgendeinem Augenblick ihres Lebens, schon einmal gehabt haben musste. ... Die meisten Lebenden waren genauso unerreichbar wie die Toten. (46f) Arthur ist im Totenreich unterwegs, von Eurydike hinuntergelockt, und erforscht Berlin von unten. Dachau, Napoleon in Moskau, nach Frankreich zogen zwei Grenadier´, Stalingrad, von Paulus sind Erscheinungen jener Welt und verkörpern ihr Grauen. Das Totenreich führt Arthur in die Vergangenheit, ihn umgibt das fortgesetzte Flüstern der Toten unter jeder Gasse Berlins. Er steigt die Treppen zur Unterwelt hinunter und findet seine Familie: „Soll ich dir einen Vater und eine Mutter aussuchen?“(66), fragt er seine (unnahbare) Begleiterin, die verlorene Frau mit dem Sohn.
Das Gemälde im Schloss, Königin Luise von Preußen, ein weiterer Einstieg: Sie hatte nicht nur eine unverkennbare sexuelle Ausstrahlung, sondern es schien auch so, als wollte die Frau aus dem Bild heraus, als ertrage sie den Rahmen nicht. Eurydike wartet auf die Erlösung. Aber es könnte sein, wird angedeutet, dass sie ihren Orpheus nicht mehr erkennt. Solche Frauen gibt es nicht mehr. ... Dieser Blick ist ausgestorben. (54) Die Vergangenheit drängt in die Gegenwart herein, aber sie kommt nicht zu sich. Auf diese Weise befinden wir uns ständig im Totenreich. ... Ein immerwährendes Gespräch an ein und derselben Stelle. (107) Unerlöste Vergangenheit, unerlöste Toten, unerhörte Worte und Sätze, ein Gebrummel, Gemurmel. Unerkannt drohen ihre Geschicke zu bleiben. Das Unverständnis und die Dumpfheit gegenüber ihrem Bedeutungsüberschuss sind aus der Gegenwart genügend bekannt.

Arthur befindet sich am Ort der Produktion von Wirklichkeit, von Daten und Fakten. Der Redakteur öffnete die Tür zu einem Saal voll schweigender Gestalten an Computern. Lieber tot, er wusste später noch, dass er das gedachte hatte. (25) Von dieser Erscheinung von Wirklichkeit aus der Unterwelt hebt sich Arthur fortgesetzt ab mit seinen wesenhaften Dokumentarfilmen. Sein großes Projekt ist das Einsammeln von Authentizität, beruflich von Tod und Abgeschiedenheit, als persönliche Leidenschaft von Metaphern für das Leben: alles durch Filmaufnahmen, die Gewesenes retten, damit kein Gestus ausstirbt wie das Lächeln der Königin. Hier haben Sie wieder das Lesen, es ist als wesenhaftes Lesen klar markiert durch das Unzeitgemäße und Unangepasste. Am liebsten wäre es ihnen, glaube ich, wenn sie gar nicht mehr existierte (26), sieht Arthur die Welt in ihrer Existenz gefährdet und kämpft um sie.
Die Stadt als Buch erzählt von der Unterwelt und damit von der Vergangenheit. Auf diese Weise befinden wir uns ständig im Totenreich. (107) Das Buch ist offen nach unten und nach hinten, das ergibt die erste (grobe) Vermessung.
Im Zentrum der Erzählung ist eine scharfsinnige Tischrunde (122). Die Ritter der Tafelrunde treten aus dem Totenreich und kommen zu üppigen Mahlen zusammen. Zum Ensemble gehört der Wirt Schulze sowie Galinsky, der Tote: Er sitzt so still wie eine Statue .... als ob er in der Ferne Musik hörte. (122f) Arno, Viktor, Zenobia: Arthur lehnte sich zurück. Vielleicht, dachte er, ist das ja der Grund, warum ich immer wieder nach Berlin zurückkehre. Ein Kreis, in den er aufgenommen war (115). Von diesem Kreis gab es im Schloss ein Bild:

Es handelt sich um ein Gemälde Adolph von Menzels, das Friedrich den Großen neben Voltaire zeigt, im Kreis führender Köpfe der Preußischen Akademie der Wissenschaften, im Schloss Sanssouci. Das Bild entstand 1850 und verbrannte 1945. Es dokumentiert den Gestus des Königs, die Weisen seiner Zeit, Diplomaten, Schriftsteller und Offiziere von Rang zu versammeln und unter ihnen der Philosoph von Sanssouci zu sein.
Es ist eine Treppe, auf der in Fontanes Gedicht der Dichter und Spaziergänger dem König begegnet und angesprochen wird auf den Maler Menzel, welcher bei der Tafelrunde Voltaires Platz einnehmen soll (Theodor Fontane, Auf der Treppe von Sanssouci). Und so pflanzt die Runde sich fort. Denn auch der König war mit Bau und Einrichtung von Schloss Sanssouci eingestiegen in ein bereits seit dem Mittelalter währendes Tafeln, als König Arthur die Tapferen seiner Zeit an den Hof holte und sie auf gleicher Höhe um den Gral versammelte. Ihre Erzählungen gehören zu den großen Texten des Mittelalters – die sich somit auch in diesem Buch fortschreiben.
Die Runde verweist auf das Mittelalter; das Mahl selbst hingegen ist die Zusammenkunft derer, die von ihren Taten und Überlegungen zu erzählen haben – und ist somit selbst wiederum sprachliche Ereignisstätte von Vergangenheit. Nicht nur die Stadt selbst, deren Oberfläche und Gegenwart vom Schnee verdeckt wird, versinkt in der Vergangenheit, auch das Hauptereignis, das Tafeln, wächst auf mittelalterlichem Boden.
Das dritte Fenster in die Vergangenheit ist Elik Oranje. Die geheimnisvolle Studentin mit dem Königsnamen, die auf eigene Faust nach der mittelalterlichen Königin forscht, erscheint selbst wie deren Inkarnation. Ihre Weltfremdheit, ihr Einzelgängertum und ihre stumme Sexualität sind Marken dafür, und einzig eine Großmutter scheint Zeugin der wirklichen welthaften Existenz dieses Wesens zu sein, dessen Herkunft ansonsten nur eine erzählte ist – und somit der legendären Königin entsprechend. Immerhin scheint sie für Arthur doch sehr wirklich zu werden: Sie tritt ein in den Kreis der Tafelnden und behauptet sich dort mit der Sprache; sie tritt Arthur – wenn das gesagt werden kann – nahe, wobei die Nähe entschieden wird und sich nicht aus dem Beziehungsverlauf ergibt. Die beiden scheinen sich durch einander jeweils erlösen zu wollen von einem Bann: sie von der Narbe ihrer Herkunft, er von der Narbe seines Verlustes von Frau, Kind und Heimat.
Diese Art des Lesens, das im Text andere Texte aufspürt, kann aber nicht alles entscheiden und abschließen. Offen bleibt etwa die Rückfrage nach Odysseus, dem Held Arthurs Jugendzeit, oder nach Orpheus, der seine Frau aus der Unterwelt erlösen will, der ebenfalls genannt wird. Beide auf schwieriger Fahrt, auf eine Frau zu. Der eine ringt mit Zyklopen (88), der andere begegnet Schatten. Der eine, der Tatkräftige, findet und befreit sie, der andere, der Sänger, verfehlt sie. Jedenfalls ein Reisender ohne Gepäck (11), Arthur, der mit Ungeheuern zu tun hat und mit Toten. Aber das ist noch nicht alles, was ich sehe. Es ließe sich noch etwas sagen über den Horizont dieser Reise.
Was uns immer wieder wundert, ist, dass ihr euch so wenig wundert. (64) So hebt ein Metadiskurs an, der das erzählte Geschehen von oben und außerhalb kommentiert. Er nennt sich selbst, ganz nach antikem Vorbild, der Chor. Der Chor der Engel begleitet die Menschengeschichte und wundert sich darüber. Er hat die Menschheit im Ganzen im Blick, Zeit und Raum, Ewigkeit, Gott, Geschichte – und das Verhalten der Menschen darin. Die Wesen, die sich nur die Begleitung nennen und nicht selbst richtig leben dürften (64), sind schon bei Peter Handke und Wim Wenders im Himmel über Berlin (1987) zuhause. Ihr erster Kommentar hinsichtlich der menschlichen Vergänglichkeit: Es ist, als explodierte die Zeit hinter euch in einem fort. (65) Das sind, vom Himmel, vom Jenseits aus gesehen, schlechte Vorzeichen für eine Rekonstruktion der Vergangenheit. Die schlafende Elik möchte mit der Hand die Wahrheit aus dem Buch ziehen wie einen Körper, wie die vergangene Zeit und die ferne Königin, wie eine Ausgrabung, aber ihr könntet nicht damit umgehen (206), sagen die Engel. Ein Licht der Vergeblichkeit, in dem die Handlung erscheint. Vergeblich, sich den Toten zu nähern. Also Orpheus. Umsonst, die Heldentaten. Doch Odysseus? Die wissenden Engel staunen selbst über den Menschen: wie schlecht ihr in euer eigenes Dasein paßt. (64) Immerhin wird es zum Rätsel erhoben, wie weit der Geist des Menschen geht und wie viel Raum er einnehmen kann.
Der Horizont des Himmels überspannt auch die Unterwelt. Orpheus sinniert über die Toten: Er war hier, aber sie waren allgegenwärtig, sie hatten keinen Ort mehr und waren überall, sie hatten keine Zeit mehr und waren immer da. (147) Seine gestorbene Frau, die nie ganz von dieser Welt war (149), hat ihm somit eigentlich den Horizont gewiesen, in den Worten des Johannesprologs. Sucht er nun die Welt oder den Himmel, wenn er Völker besucht, die eine Schöpfung hatten, die für sie allein geschaffen war und deren Schritte über trockene leere Landschaften er filmt. Als er sich trotz Warnung nachts allein aus der Stadt wagt, überfällt ihn das Nichts, die totale Stille: so war der Himmel auf ihn gefallen (154), und darin waren drei Gestalten erschienen, die aus der Tiefe von Jahrtausenden gekommen waren. Er hatte ohne Angst bestanden, weil er nicht in diese Welt gehörte (155) und, wie die Engel sagen würden, schlecht in sein Dasein passt. Denn die ganze Welt war ein Verweis, alles verwies auf etwas anderes zurück (156) Auf die Geschichte, das Gewordene. Der Mönchsgesang ist das Röcheln der Ewigkeit. (200). Gleichwie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt (282f), liest man in Kohelet. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war (283) , wird Psalm 139 gelesen, die größte erreichte Weite, die weiteste Offenheit nach vor und zurück und aus der Zeit heraus, im Zitat zwar und nicht im Bekenntnis, aber wie kann Sprache weiter aus der Welt hinausweisen als im Zitat, zumal eines Lehrers für einen Suchenden und Fragenden. Zenobias Leidenschaft für Raumfahrt können diesen Horizont nicht ausfüllen, und Arthurs Abenteuerfahrt hinter der Erscheinung der Königin her wohl auch nicht, obwohl beide in gewisser Weise die Grenzen der Schöpfung durchmessen im Wagnis. Die Geschichte, die mit einem Vorübergang an der Buchhandlung und somit mit dem Lesen begonnen hatte, läuft auf den sichtbar werdenden hohen Himmel des Nordens zu, eine Durchquerung der Schöpfung in allen Richtungen von Raum und Zeit.
Handke war schon am Wort – das zweite Buch soll Langsame Heimkehr sein, ebenfalls eine Reisegeschichte, und mehr als die vorige, und zugleich, so sei es gleich voraus gesagt, eine innere Reise durch die Schöpfung. Mit den gewonnenen Wegmarken lassen sich die Etappen leichter abstecken. Sorger, der Geologe und Naturforscher – Schöpfungsforscher, möchte man beinahe sagen – untersucht über Jahre eine Flusslandschaft im hohen Norden Kanadas, wo im Verborgenen die Schotterkugeln dahinglitten, sich rollend überschlugen oder sogar langsame Bogensprünge vollführten, eingehüllt in Schlammwolken und weiterbefördert von natürlichen Wasserwalzen, welche – tief unter der stillen Oberfläche in der Gegenrichtung rotierend – er sich nicht denken, sondern sinnlich miterleben konnte (12f). Er hat ein Gespür für die Formen unter der Oberfläche, für die Wellen und Kurven, die Hebungen und Senkungen, für die räumliche Tiefe, möchte man sagen, und auch für die zeitliche, in jahreszeitlichen und erdgeschichtlichen Skalen.
Der Name Sorger? Der Forscher geriert sich nicht als objektiver, unbeteiligter Beobachter, sondern sieht seinen Auftrag darin, seine Anstrengung, das Befremdende jeder Erdgegend auszuhalten (16) – es ist eine Weltvertrauens-Übung, ein Teilhaftigwerden an „seinem Gegenstand“ (17). Der Sorgende ist Teilnehmer, Mitbetroffener, Vollzieher der Natur in ihren Dimensionen: Raum und Zeit konstatiert er wörtlich mit (in) seiner Existenz, über Jahre in der Tundra. Aber nicht nur das: In diesem Zeitraum war ständige Gegenwart, ständige Allerwelt, ständige Bewohntheit. Die Gegenwart war eine Allgegenwart, wo die einst geliebten Toten mitatmeten (52). So ist bereits mit wenigen Strichen ein Schauplatz gezeichnet, der, nunmehr in der wilden Natur, ebenso wie vorhin in Berlin den Untergrund, das Gewordene und Gewesene aufleuchten lässt, bewohnte Schöpfung. Die Indianerfrau, die Katze, der Kollege Lauffer, das Dorf: alles Erscheinungen des Grundes, ließe sich sagen, wie die plötzlich erschienenen Aborigines am nächtlichen Rand Alice Springs, als Arthur die Stille des Nichts erfahren hatte: Epiphanien des Grundes. (Ich könnte weitere anführen, aus dem nächsten und übernächsten Text, vielleicht komme ich dazu.)
Von dort reist Sorger ohne genannten Grund ab, über mehrere Stationen nach Europa, eben die langsame Heimkehr. Die nächste Station an der Pazifikküste bringt eine Veränderung seiner Naturwahrnehmung. Zunächst durchstreift er die Dünenlandschaft, er, der auf den Grund gesehen hat und von dort seine Sprache bekommen hat (104) – aber fern von der Schöpfung (130) erfahrt er eine Versagung der Lebendigkeit und Zugänglichkeit der Natur: Eine Maschine empfing ständig die Tonwellen aus dem Erdinneren, ... ein ... fast singender Klang (131). Eine Versagung auch von Menschen, die ihn nicht erkennen: Dann wurde der Boden zu seinen Füßen so deutlich, als sei er schon gestürzt. (137) Und in der hereinbrechenden Einsamkeit überwältigt ihn eine unbekannte Unbehaustheit: Das Meer wurde unheimlich. – Zerstört war der Lebensplan .... aus dem Untergrund fuhr „der lebende Tote“ in ihn .... und er sah...die Seele ... hatte Sorger ein Erdbeben erlebt .... so schien ihm jetzt auch das eigene Ende ganz nah .... die Weltenrichterstimme ..... „Danke, ihr Mächte.“ .... „Göttlicher anderer.“ .... Erlebnis der „Schwelle“: wieder im Spiel der Welt sein. (137-141) In dieser erdbebenreichen Küstenlandschaft wird mit Naturmetaphern eine Grunderfahrung erzählt: der Existenzgrund, im ganzen Buch stets unterschwellig gegenwärtig, wird erschüttert, ohne erkennbaren Anlass, ein Ereignis in aller Stille und Einsamkeit. Dieser zweite Abschnitt der Heimkehr heißt Raumverbot – der Naturraum/Weltraum hat sich in seiner Bedeutungskraft entzogen.
Der dritte Abschnitt heisst Das Gesetz. In Abweichung von seinem Plan bleibt Sorger an einem Ort, wo er jemanden kennt. Ihn will der Einsame besuchen, und erfährt gerade von seinem Tod. Vor dem Sarg beweint er den Toten und die anderen Toten. Aufschauend glaubte er zu sehen, wie diese gewaltig über ihn lachten. Er lachte mit ihnen. (166) Diese Begegnung mit dem Tod/Toten führt Sorger neu in eine Behaustheit zurück, der sogleich in der Schneelandschaft in einer schimmernden Furche: die schönste Frau, die er je gesehen hatte, erblickt und somit seinen Naturalismus wieder hat. Was hat sich geändert? Er sieht die Inbilder seiner Verstorbenen, es zieht ihn zu den Abgeschiedenen hin, er gelangt in ein Neubegreifen der Zeit, stellt sich die Zeit als einen „Gott“ vor, der „gut“ war. (173) Gerade in der Großstadt, seiner letzten Station, findet er wieder zum Bewußtsein „seiner“ Erdformen zurück (179). Es ist die Sorge um einen Menschen, der sich ihm anvertraut, die ihm einen Tag in der großen Stadt schenkt, wo er aus dem tiefen Nacht-Raum wie von einem Schauder der Schöpfung überflogen wird (183). Er sieht in einer Vision die Große Handschrift, in der sein Leben beschrieben wurde (201), das als Begegnung der Elemente (Spiegel, Nichts und Gravität) gesehen wird. Diese apokalyptische Vision zeigt, dass die Geschichte der Menschheit bald vollendet sein würde (209), und führt Sorger in eine Sonntagsmesse, wo er gewahr wird, wie ein Schwanken durch die Welt geht, während Brot und Wein gewandelt werden: in ähnlicher Weise (206), also gewandelt, streift er wieder durch die Straßen, vorbei an Bekannten und Unbekannten, und ein Schulfreund erkennt den Gewandelten und erkennt ihn nicht: „Wie der Valentin Sorger!“
Die Welt/die Schöpfung ist wieder zum bergenden Haus geworden, weniger durch einen Persongott, eher durch eine pantheistische Natur. Die Dimensionen der Schöpfung verlaufen im Untergrund, in den geologischen Formen und Abläufen, in der Totenwelt, in Schuld und Gutsein – und zuletzt in einer Art geschenkter (gnadenhafter) Identität. Freies Handeln (Subjektivität) und Gefühl der Eingebundenheit (Gnade) sind verflochten und nicht entwirrbar. Was bei Nooteboom Literaturzitat, ist bei Hanke sozusagen Naturzitat – bedeutungsüberschießend beide. Schöpfungsmetaphern des Werdens und Vergehens, des Ereignishaften, das innerweltlich rätselhaft bleibt und zur Deutung eine externe Perspektive braucht, je in vertikaler Dimension, von Engeln und Toten.
Mehr noch als für die bisherigen Texte gilt das für den dritten: Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien, unter besonderer Beachtung der neunten, und mit einer gewissen Neugier für die Sonette an Orpheus im Hinblick auf das erste besprochene Buch, welche sich im selben Band befinden.
(Der vierte und letzte Text dieses Gevierts wird Robert Musils 4.Kapitel Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch Möglichkeitssinn geben aus Der Mann ohne Eigenschaften sein. Mit diesen vieren ließe sich ein Schöpfungsverständnis umreißen, das, so meine ich, auf der Höhe unserer Zeit sein könne.)

weichensteller - 1. Mär, 22:52





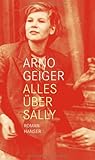












Die Semantik der Nischen
Nis, Nische: „Etwas in dem man sich verbergen konnte oder in dem man etwas Verborgenes fand … Er versuchte, das Wort (!) lozuwerden, doch es gelang ihm nicht mehr …“ (9) „New York, Madrid, Berlin, überall, denkt er jetzt, eine Nische.“ (11)
Nische, Mauervertiefung: Stammwort ist lat. nidus, „Nest“ (Duden Bd. 7)
Eben jenes Aufspüren von Nischen, des Verborgenen, macht den Reiz des Lesens dieses Romans aus. Die Nische wird Zufluchtsort auf der Suche nach Geborgenheit (Nest) aber auch zum Raum der Zeitlosigkeit, der flüchtigen Berührung von Endlichkeit und Unendlichkeit.
Im Folgenden sind die aus meiner Perspektive im Roman angesprochenen Nischen angeführt:
1. Pallas Athene, Brandenburger Tor
„Er ging zu der Figur der Pallas Athene in einer der Nischen und legte eine Hand auf ihren großen nackten Fuß.“ (155)
Die Nische der Weisheit mitten in der Narbe (die dritte!) der Stadt, des Kontinents.
2. Der Film/das Filmen
"Filmen war nicht Lesen, so waren diese Stunden zwischen Nacht und Tag und dann wieder diese anderen zwischen Tag und Nacht seine Spezialität geworden (…) inklusive der Fast-Unsichtbarkeit.“ (73) Warum filmen? Um etwas zu suchen, „…das er damals, irgendwann gesehen hatte und nie wieder sehen würde. (…) was davor hier gewesen war, was er nur von Fotos kannte?“ (75) Diese Identifikation führt so weit, dass Arthur sich selbst in Form seines Schattens in den Film eingliedert. Der Schatten des Filmers als „Dazwischen“, als Nische zwischen Vergangenheit und Gegenwart. (90)
Der Film wird als Möglichkeit dargestellt, Verborgenes festzuhalten, von der Vergangenheit in die Gegenwart zu führen, im Gegensatz dazu steht das statische Bild, das unwiderruflich Vergangenes repräsentiert. Beispielsweise das Bild der Luise von Preußen (53), zu dem ein Bezug zu Arthurs Frau Roelfje hergestellt wird (57), das Bild seines Sohnes Thomas (147), das Bild von Frau und Kind bei Erna (175) und in seiner Wohnung während des Besuchs von Elik (278), bis hin zu den Röntgenaufnahmen der Toten (149) und das Foto des Flusses auf dem Umschlag des Fachbuches über die Königin Urraca. (209)
3. Erna
Die erdige Mutter Erna, die mit ihren handfesten Weisheiten gleichsam einen Gegenpol zu Pallas Athene darstellt, als „Nische“ zwischen der verstorbenen Ehefrau und der seltsam entrückten, Spuren legenden, schweigenen Sirene Elik, die den Tod um sich hat (416), beide, Roelfje und Elik, nicht greifbar, mit beiden verbinden Arthur die toten/ungeborenen Kinder. Erna hingegen ist die, die immer da ist, als innere Stimme, und somit Zufluchtsort im Ich des Hauptdarstellers und dennoch real vorhandene Bezugsperson abseits der „Tafelrunde“.
4. Der Fluss
Der Fluss als Nische (Symbol) zwischen Leben und Tod, Diesseits und Jenseits.
Beispiele dazu:
Die Überfahrt auf die Pfaueninsel und Eliks Davonlaufen. Die Erinnerung des Fährmanns an die letzte Überfahrt. (226)
Das Foto (!) des Flusses auf dem Buch über die Königin Urraca (209)
Bevor Arthur am Ende des Romans weiterfährt, filmt (!) er den Fluss nahe seiner Raststätte. (435)
5. Allerseelen
Ein Fest der Lebenden für die Toten. Eine Nische zwischen Leben und Tod. Ein roter Faden, der sich durch den gesamten Roman zieht.
Die Begriffsklärung erfolgt am Ende gleichsam als Antwort auf das einführende Philosophieren über das Wort „Nis“ am Anfang.
Allerseelen: „Er wusste nicht genau, was er sich darunter vorzustellen hatte, aber er hatte den Eindruck, das Wort (!) habe mehr mit Lebenden als mit Toten zu tun.“ (434)
Die Abwendung vom Westen (dem Land der untergehenden Sonne, Filmen des Flusses zu Sonnenuntergang), ist letztendlich auch eine Entscheidung gegen die neu gelegte Spur Eliks (die den Tod um sich hat) und die Zuwendung zum Leben (Filmen des Flusses nach Sonnenaufgang) am Ende des Romans, nachdem er dem Ort des Todes seiner Familie (Malaga, Spanien) sehr nahe gekommen war:
„Nur das unmögliche Auge hoch da oben hätte sehen können, dass das Auto an der Kreuzung kurz gezögert hatte, sich dann aber vom Westen abgewandt hatte (…) und der hohe Himmel des Nordens sichtbar wird.“ (436)
Ob die Nische, das Dazwischen, bei Überlegungen zu einem modernen Schöpfungsverständnis Raum finden kann, wage ich nicht zu beurteilen. Aber denkmöglich wäre es.
Die ökologische Nische
Die Nische ist da, wo man bleiben will, sich verstecken, hineinducken. Abwarten, bis der Sturm vorüber ist.
Der Film als Nische? Dann nicht eher das Bild als Nische, oder der eigene Schatten innerhalb des Filmes als der kleine gleichbleibende Winkel zum Festhalten?
Zur "erdigen" Erna vgl. Handke, Heimkehr, 166: die schönste Frau! - Aber warum dann die Verweigerung der Nahbaren zwischen den beiden in den Grund entschwundenen, zu Grunde gegangenen?
Der Fluss als Lethe, das stimmt. Durchzieht die ganze Geschichte.
Zu Ost und West: Das sind doch die Richtungen des Werdens und Vergehens, im Osten wird der Tag/die Zeit geboren, im Westen stirbt er/sie. Dann ist ganz Berlin im Zwischenreich: die Ebene bis Russland, der unverstandene holländische Nachbar. Die Spanienreise wie Orpheus´Abstieg ins Grauen, die Rückkehr ans Licht.