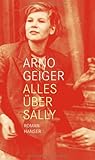was ich lese
Sie werden bestimmt nicht gedacht haben, dass Sie hier ein Fachvortrag erwartet zu den beiden angekündigten philosophischen Büchern, die bereits vor Jahrzehnten erstmals und nun neuerlich erschienen sind, und womöglich dazu angeregt oder gar aufgefordert werden, diese Bücher zu erstehen und anschließend selbst durcharbeiten zu müssen – denn diese Veranstaltung ist ja kein Leseseminar, sondern eine Präsentation privater Lektürevorlieben mit einem gewissen Unterhaltungswert. Andererseits erwarten Sie von mir zu Recht Ehrlichkeit bei der Literaturangabe, sodass ausgeschlossen werden kann, dass ich hier Texte präsentiere, die ich gar nicht gelesen habe, oder Texte auslasse, die ich sehr wohl gelesen und sogar da und dort erwähnt habe. Das trifft nämlich gerade bei dem umfangreichen Buch von Panajotis Kondylis zu, das ich vor Zeugen mehrfach das Buch des Jahrzehnts genannt habe, weshalb ich jetzt nicht mehr umhin kann, es auch vorzustellen. Meine Zwickmühle ist aber mit dem Gegensatz zwischen ernster Philosophie und launiger Unterhaltung noch nicht vollständig wiedergegeben, denn das noch größere Dilemma besteht darin, dass Sie das Thema dieses Buches und wahrscheinlich meiner ganzen Literaturwahl auch persönlich betreffen wird, weil jedenfalls zu erwarten ist, dass Besucher von Vorträgen recht bürgerliche Leute sind, zumal in einer Buchhandlung. Man könnte ja auch der Meinung sein, dass Angriffe auf Bürger nicht in Büchern erfolgen sollen, weil doch Bücher fast nur von bürgerlich eingestellten Menschen gelesen werden, und somit Bürgerkritik in Buchform früher oder später das Kulturgut Buch abschaffen würde – oder auch den Bürger – und vielleicht ist das ohnehin bereits im Gange oder schon abgeschlossen.
Und somit verspreche ich, heute nichts über Kondylis zu sagen, obgleich es sich um ein brillantes und leider nur in Fachkreisen bekanntes Buch handelt. Wahrscheinlich hat Kondylis das auch selbst so gewollt, denn er hat sich konsequent aus dem akademischen Wissensbetrieb herausgehalten, so konsequent, wie ich das sonst nie gesehen habe. Man stelle sich vor, 300 Seiten über die Ideen- und Motivgeschichte des Bürgertums zu schreiben, ohne ein einziges Werk, einen Künstler, Wissenschaftler, Politiker oder ein Datum zu nennen! Natürlich erhöht das weder Verständlichkeit noch Lesevergnügen, abgesehen von einem gewissen detektivischen Reiz, den es hat, Andeutungen zu folgen und sich falsche oder richtige ungenannte Autoren oder Werke vorzustellen. Außerdem disqualifiziert sich das Werk ja bereits durch seinen Titel, denn was soll an einem Bürgertum noch interessant sein, wenn es angeblich bereits untergegangen ist. Wahrscheinlich muss das Buch selbst zu dem darin konstruierten Phänomen gerechnet werden, dessen Erscheinen und Verschwinden auf hunderten Seiten ausgebreitet wird, ohne ein einziges Faktum zu nennen. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass ich dieses Buch auch niemals besessen habe, denn es war seit Jahrzehnten vergriffen, und die jüngste Neuauflage erschien zu einem stattlichen Preis.
Bei Formulierungen wie der folgenden denke ich unwillkürlich an bestimmte Menschen, deren Lebenshaltung mich zugleich fasziniert wie auch abgestoßen hat, ohne dass ich das damals, als Schüler und Student, noch einer bestimmten sozialen und ideologischen Figur wie dem Bürgertum hätte zuordnen können. Aber hören Sie selbst:
„Derselbe Wunsch, Natur und Vernunft, Geist und Materie, Norm und Trieb im Rahmen eines übergreifenden harmonischen Ganzen miteinander in Einklang zu bringen, beflügelt die bürgerliche Anthropologie. Das Harmonisierungsbestreben, das auf ontologischer Ebene in der doppelten Abgrenzung gegen den Dualismus und den Monismus bzw. den Spiritualismus und den Materialismus gründete, entstand im Bereich der Anthropologie aus der doppelten Abneigung gegen das restlose Aufgehen des Menschen in der materiellen Natur und gegen eine solche Erhebung über die Natur, dass er nur im Himmel seine wahre Heimat finden könnte. (...) Die Auffassung, der Mensch herrsche kraft seiner Vernünftigkeit über die eigene Natur, hing freilich auch eng mit der Überzeugung von der Beherrschbarkeit der äußeren Natur und dadurch mit der modernen Naturwissenschaft und dem Glauben an die Naturgesetzmäßigkeit zusammen.“ (30)
Ich habe in jugendlichem Alter solche Haltungen, die mir in imposanten Persönlichkeiten, z.B. einem Priester und Religionslehrer, begegnet sind, für lauwarm und inkonsequent gehalten. Dennoch hat gerade er mir Kirche und Glauben mit Nachdruck unter die Nase gerieben. Jüngst habe ich sein Gedenkbild wiederentdeckt, auf dem er stolz vermerkt: „Kirchliche Auszeichnungen: Keine. Auszeichnung durch einen Jugendlichen: Wenn sogar du in dieser Kirche bist, dann bleibe ich auch!“ Der hier bezeugte Gegensatz zwischen einer starken Präsenz bei Menschen und einem theologischen Konservativismus, bestimmten mein Kirchenbild in jungen Jahren, eigentlich bis zum Theologiestudium. Es war kein Darum-Glauben, sondern eher ein Trotzdem-Glauben. Auch die Rede von der Naturliebe machte mich misstrauisch. Vielleicht sind die am Plan abgehakten Wanderwege eher ein Instrument der Herrschaft und Selbstbestätigung. Die Art von Vernunft, die mir damals von der älteren Generation begegnete, schien mir überaus interessengeleitet zu sein, und was daran sich als religiös gab, war wenig glaubhaft.
„In der Geschichte entfaltet oder aktualisiert sich die menschliche Natur – und der Versuch, in jener Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen oder dem Einfluss materieller Faktoren, von den geographischen bis zu ökonomischen, auf die Spur zu kommen, entsprang im bürgerlichen Denkrahmen nicht so sehr der Wunsch, die menschliche Autonomie zu relativieren, sondern eher der Absicht, den unberechenbaren Einmischungen Gottes in das Weltgeschehen ein Ende zu setzen. (...) Der bürgerliche Evolutionismus (...) bildete den Gegenbegriff zum theologischen Fixismus, der seinerseits den Ewigkeits- und Unveränderlichkeitsanspruch der societas civilis in den Kosmos hineinprojizierte. In der bürgerlichen Vorstellung paarte sich indes die Idee des Fortschritts und der Entwicklung mit der Idee der Ordnung“ (33)
Somit erschien mir das Streben nach Beherrschung der Natur, auch der eigenen, z.B. mit Hilfe der Vorstellung Freuds von der Triebökonomie, indem man sich gerne kleine Laster gestattet zugunsten der Ablenkung von stärkeren Bedürfnissen, als wenig überzeugend. Die Abdrängung Gottes zu einem Wunderwirker in beschränktem Rahmen konnte ich zwar als Argumentationsfigur anwenden, aber wirkliche Erkenntnis erwartete ich davon nicht. Mein Gefühl warnte mich davor, mich einem solchen wohlgeteilten Bürgerhimmel zu verschreiben, wie mir auch für meine Wohnung und meinen Tagesablauf übertriebene Ordnung verdächtig war, und mich stets mehr das Unvorhergesehene interessierte, und das, was aus der Reihe trat. Mein Kampf gegen die bürgerliche Weltvermessung wurde auf Radtouren und Reisen per Anhalter ausgetragen, und die Benützung des Privatautos von Einzelpersonen trotz möglicher Alternativen erscheint mir bis heute als unmoralisch und engstirnig. Wahrscheinlich habe ich deshalb nicht in den vorgesehenen Lebensjahrzehnten geheiratet und eine Familie gegründet, sondern bin Vagabund geworden.
Aber solche Konsumgewohnheiten sind nach Kondylis eigentlich als nachbürgerlich zu betrachten, obwohl sie unzweifelhaft die ehedem bürgerlichen Anliegen darstellen, nur dass sie inzwischen einer Masse zugänglich geworden sind, in die hinein die historische Formation des Bürgertums sich inzwischen aufgelöst hat. Und während meine Generation immer noch den vermeintlich heroischen Kampf der 68er gegen das System hochhält, breitet Kondylis ein Beispiel um das andere aus, um den Übergang vom bürgerlichen Wertekanon zum massendemokratischen Konsumkanon zu beschreiben als die gesellschaftliche Durchsetzung der früheren bürgerlichen Anliegen.
„Die Abschaffung des bürgerlichen Bildungskanons geht ... mit dem Kampf gegen die Autorität und mit dem Bestreben einher, Spontaneität und Kreativität als Voraussetzungen für die Selbstverwirklichung zu entwickeln. (...) Wir meinen die grundsätzliche soziale Nivellierung der Altersstufen, die genauso wie die angestrebte Beseitigung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern aus dem Aufstand des Egalitarismus gegen die Biologie folgen muss. (...) Vor diesem Hintergrund entsteht der massendemokratische Kult der Jugend und der Jugendlichkeit, dem die Älteren ständig Rechnung tragen müssen, indem sie sich mit unterschiedlichem Erfolg bemühen, möglichst lange fit zu bleiben....“ (220)
Man sieht, wie sich die Aufklärungsideale vom freien Subjekt durchgesetzt haben in der modernen Massendemokratie – ein Leitbegriff bei Kondylis – für die Selbstverwirklichung zum Dogma geworden ist. Die Freiheitsforderung geht so weit, einerseits völlige Angleichung aller zu fordern: der Männer, Frauen, Jugendlichen, Kinder, Senioren, Reichen, Armen, und sowohl Forderung wie auch Umsetzung durch dem Massenkonsum von Gütern zu gewährleisten. Frauen, Kinder und Senioren traten deshalb ins Rampenlicht, weil sie als Konsumenten gebraucht wurden am bereits gesättigten Markt. Andererseits geht die Freiheitsforderung der anspruchsvoll gewordenen Konsumenten auch gegen die eigene Natur. Empfängnisverhütung und Abtreibung, Lebensverlängerung, künstliche Befruchtung, Manipulation am Erbgut oder Neubewertung von Homosexualität haben den Menschen mehr Verfügung über die Natur gebracht, aber auch viele neue Probleme und Fragen.
Es ist wohl das, was mich an Kondylis´ Untersuchung so beeindruckt hat, dass der Zusammenhang zwischen bürgerlichen Einstellungen, liberal oder konservativ, mit heutigen Konsumhaltungen und ihrem ungeniert zur Schau getragenen Hedonismus so klar nachgezeichnet wird. Ich beginne zu verstehen, wie noch so konservativ eingestellte Persönlichkeiten zugleich ohne jede Zurückhaltung sich modernster Konsumartikel bedienen und jeden Trend mitmachen können, ohne das als Widerspruch zu empfinden.
Was noch aussteht, und das interessiert mich ja stets am meisten, ist die Neubewertung der Rolle, die Bürgertum und bürgerliche Haltungen und Werte in der Kirche spielten und heute spielen. Ich frage nach der bürgerlichen Theologie, für die Kants Schrift „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ vielleicht ein Schlüsselwerk war, und nach ihren philosophischen und gnostischen Verästelungen bis zur Esoterik, jeweils im Horizont der abendländischen Kirchenspaltung durch den Protestantismus. Die Pole bürgerlicher Religion, der Deismus und der Pantheismus, sind wahrscheinlich Voraussetzungen und zugleich Begleitumstände der aufkommenden Naturwissenschaft, die nach wie vor regelmäßig Weltdeutungen produziert, ohne dass diese kirchlich wahrgenommen oder beantwortet würden. Zugleich ist auch unser Kirchenbetrieb selbst von bürgerlichen Interessen durchzogen, die als kirchlich erscheinen und in einem fort Machtkämpfe generieren, und vielleicht ist ein Leben aus dem Glauben gar nicht anders als mit einem bürgerlichen Schatten vorstellbar. Hat jemand dazu eigentlich schon einmal die heilige Schrift befragt?
Nun möchte ich mich einer womöglich noch sonderbarer und eigenwilliger Buch-Erscheinung zuwenden, nämlich Josef Mitterers „Die Flucht aus der Beliebigkeit“. Der Philosophieprofessor an der Klagenfurter Universität führt auf knapp 200 Seiten und in 160 Paragraphen vor, in welcher Beliebigkeit philosophisches Denken, und Denken und Argumentieren überhaupt, sich bewegt, und wie alle erreichten Positionen, als Rationalismus und Empirismus, Konstruktivismus und Dekonstruktivismus usf, stets nur das für sich in Anspruch nehmen können, dass ihre Vertreter sie eben vertreten. Die dargestellten Richtungen erscheinen als Glaubensrichtungen, die sich jeweils im Besitz der Wahrheit sehen, und untereinander dogmatisch argumentieren. Warum aber jemand eine bestimmte philosophische Auffassung vertritt, liegt nach Mitterer an dessen Biographie, wer seine Lehrer waren, und wo er studiert hat, und nicht an der Wahrheit der Auffassung, denn diese ließe sich niemals gültig darstellen gegenüber anderen Positionen. In lakonischem Stil führt er das seitenweise vor, mit einfachsten Beispielen und ohne Fachvokabular. Alle großen philosophischen Fragen erweisen sich solcherart als ungelöst, und man kann staunen über den großen Aufwand, der über Jahrtausende betrieben wurde ohne gültige Ergebnisse.
Es geht Mitterer dabei um das, was allen philosophischen Denkschulen gemeinsam ist, nämlich dass sie zwischen der Welt und dem Diskurs über die Welt unterscheiden. Er nennt das dualistische Redeweise. Sie findet sich in der Gegenüberstellung von Sein und Denken, Subjekt und Objekt, Idee und Wirklichkeit, Sprache und Sein, Wort und Ding. Indem zur Welt das Reden über die Welt gesetzt wird, entsteht ein Entsprechungsverhältnis. Diese Entsprechung kann zutreffen oder nicht zutreffend sein, wahr oder falsch. Auf der Ebene des Redens entstehen nun Methoden und Regeln, die eine wahre Aussage von einer falschen unterscheiden. Dabei versucht jede Argumentation, im Reden die Sprachebene zu verlassen und die Ebene der Wirklichkeit zu erreichen. Dieser Übergang ist der Wahrheitsdiskurs. Nur, so Mitterer, sei das Problem des Übergangs eben ein Folgeproblem des dualistischen Denkens, und auf langen Seiten führt er das mit immer neuen Ansätzen und Beispielen als zirkulären Vorgang vor, bis dem Leser schwindelt und er sich zu fragen beginnt, ob denn da kein Ausweg ist aus dem Strudel.
Er mag sich erinnern an die Sprachkritik des frühen Wittgenstein, die Elementarsätze fordert zur genauen Wiedergabe der Tatsachen, und andere Reden zurückweist, oder an die Sprachspiele des späten Wittgenstein. Mitterer verleugnet diese Verwandtschaft nicht. Aber zeigt nicht gerade Wittgenstein die Parallelität zwischen Sprache und Sein erst recht? Näher verwandt erweist sich sein Denken mit dem Konstruktivismus, aber auch diesen überführt er in einem eigenen Anhang des dualistischen Denkens. Weniger aufmerksam scheint die Kritik an Mitterer für dessen Verbindung zu erkenntnistheoretischen Positionen Nietzsches zu sein. Dessen berühmter Aphorismus 22 aus Jenseits von Gut und Böse führt die Wissenschaft vor, die Naturgesetze findet und zu Tatsachen erklärt. Er bestreitet, dass die Objekte der Wissenschaft der Text wären, den sie rekonstruiert, und von dem sich durch Interpretation und Ableitung die moderne Technik und Lebensweise gewinnen ließe. Der Tatsachentext, der Kult des Faktischen, sei selbst Interpretation, so Nietzsche, und der gesuchte Boden des Faktischen, auf dem wir stehen, bloßes Wunschdenken. Er nennt das den zweiten Atheismus, den entmachteten Glauben an die Naturgesetze.
Nietzsche öffnet in dieser erkenntnistheoretischen Grundsatzdiskussion das Tor zur existenziellen Dimension. Er könnte beinahe als der Entdecker der interessensgeleiteten Argumente gelten, der aufzeigt, was es jemand nützt, so oder so zu denken und zu argumentieren. In seiner Genealogie der Moral hat er das mit Nachdruck ausgeführt. Er gibt uns damit einen Fingerzeig zurück zum eingangs untersuchten Bürgertum und seiner Geisteshaltung. So soll also nun Mitterer nach seiner eigenen Position befragt werden, da ja nach dessen Dekonstruktion der Philosophiegeschichte schwer noch eine von dessen Kritik ausgenommene Position denkbar bleibt. Er nennt in einer Handvoll Paragraphen eine Nichtdualisierende Rede, die die genannten Probleme unterlaufen könne.
„Nichtdualisierendes >>Reden über<< ist nicht mehr auf das Objekt der Rede gerichtet, sondern geht vom Objekt der Rede aus. Über ein Objekt reden heißt die Rede so far in einer Rede from now on fortführen.“, sagt Josef Mitterer in Paragraph 157. Solcherart wird darauf verzichtet, einen Wahrheitsanspruch einzuführen und die Gültigkeit der eigenen Aussage zu untermauern. Stattdessen stellt Mitterer das Prinzip der Interpretation heraus, dass sie nämlich später ist als das Interpretierte. Der Unterschied zwischen den Aussagen liegt nicht in ihrer metaphysischen Ableitung, sondern im Zeitpunkt der Rede. Der den früheren interpretiert und dessen Rede über das Objekt fortführt, hat recht – bis ein anderer seine Rede wieder interpretiert. So ist die Rede über das Objekt selbst als Objekt begriffen, und fällt mit ihm zusammen. Damit ist der bisherige Wahrheitsbegriff obsolet, und die Aussagen erscheinen alle gleichwertig und auf der gleichen Ebene. Die einzig relevanten Unterschiede liegen nicht in einer Rangordnung oder Abbindung an Unbestreitbares, sondern bloß in der Reihenfolge. Das ist sozusagen ein demokratischer Wahrheitsbegriff, der es nicht nötig hat, ein Jenseits des Diskurses zu behaupten, sei es eine Wirklichkeit oder ein Ding an sich oder eine Idee.
Wenn es dabei bleibt, welche Folgen hätte ein solches Wahrheitsverständnis für unser Leben, und im besonderen für die theologische Rede? Autoritäten wie Eltern oder Lehrer hätten es dann noch schwerer, denn die Geltung ihrer Rede könnte noch weniger als bisher von ihrer Position abgeleitet und begründet werden. Der Zögling könnte jederzeit sagen: Ich interpretiere deine Rede und das, wovon du redest, anders, und meine Aussage gilt from now. Leichter aber hätten es die Prediger. Denn sowohl das jeweilige Schriftwort wie auch alle bisherigen Interpreten könnten jederzeit in freiem Sinne in eine neue Rede hineingestellt werden, sodass jede Predigt eine Zeitenwende sein möge, wie auch Jesus es verstanden hat, der sagte: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist... / ich aber sage euch: ....
Man sieht sogleich, dass der neue Wahrheitsbegriff, auf den Mitterer zugeht, mit der Persönlichkeit zusammenhängt, der ihn vertritt, und mit seinem Geist. Die Behelfe können auf Dauer nicht vor falscher Rede schützen, die Person muss als überzeugend erfahren werden, der Erweis liegt in der Präsenz der Person. Und wenn es strittig sein mag, wer nun recht hat: nun, so warten wir eben auf den, der danach kommt und redet. „Gesetzt, dass auch dies nur Interpretation ist – und ihr werdet eifrig genug sein, dies einzuwenden? – nun, umso besser.“ (Jenseits von Gut und Böse, Aph 22)
Die Wendezeit, die sich, wenn schon nicht bei Kondylis oder Mitterer, so doch zumindest in meiner Interpretation abzeichnet, wie sie mit den Wendungen so far/from now markiert ist, spielt, wie man bemerken wird, bei meiner Literaturwahl eine große Rolle. Dabei gebe ich nicht allein der Zeit und ihrer Texte die Schuld, sondern bin bereit und gefasst, auch das Lesen selbst gebührend in die Pflicht zu nehmen. Eine Art Lesens wie das vorgestellte vermag ja überall, Wendezeichen zu finden, oder das Lesen wendet selbst die Zeichen, bis ein neuer Sinn erkennbar wird. So gestehe ich unumwunden, dass selbige Ergebnisse auch aus jeglicher anderer Literatur gezogen hätten werden können, sodass die schließlich erzielte Auswahl sich mehr pragmatischen Erwägungen verdankt, wie der Verfügbarkeit der Texte (bis auf einen), ihr jüngeres Erscheinungsdatum, oder auch bloß die Quantität der Zeit und Interpretationen, die ich mit ihnen verbrachte. So würde ich gerne versuchen, einen Textauszug von Gerhard Rühm mit Ihnen gemeinsam zu untersuchen, um darauf zu achten, was in einem solchen Text liegen mag oder was wir Leser darin finden wollen:
ABAELARD UND HELOISE
achleitner. eisenbahnstreik. aeschylos. sämtliche dramen. albrecht. abriss der römischen literaturgeschichte. albumblätter. alexis. die hosen des herrn bredow. cabanis. der roland von berlin. der werwolf. der falsche woldemar. andersen. bilderbuch ohne bilder. glückspeter. der improvisator. nur ein geiger. sämtliche märchen. sein oder nichtsein.
anschütz. erinnerungen aus dessen leben und wirken. griechische anthologie. apel und laun. gespensterbuch. archenholtz. geschichte des siebenjährigen krieges. ariosto. rasender roland. aristoteles. die poetik. verfassung von athen. arndt. erinnerungen. gedichte. wanderungen mit stein. bettina von arnim. goethes briefwechsel mit einem kinde. arnim-brentano. des knaben wunderhorn. arnold. die leuchte asiens. augustinus. bekenntnisse,.
Ich würde diesen Textauszug gerne sogleich mit Ihrem Einverständnis als anarchistisch bezeichnen. Wie Sie jetzt nicht sehen können, schreibt Gerhard Rühm in radikaler Kleinschrift, das bedeutet, ohne jede Hierarchie im Schriftbild, kein Buchstabe vor anderen ausgezeichnet, alle vor Gott gleich. Das einzige verwendete Satzzeichen ist der Punkt. Damit sind alle Textteile ebenfalls gleichwertig nebengeordnet. Da kein Satz vorliegt, gibt es auch keinen Satzbau, welcher die Glieder in eine Ordnung zwingen würde. Zwar hat der mit mehreren Seiten längste Text des Buches eine Überschrift, aber diese fügt ihn bloß ins Buch ein, innerhalb des Textes sind die beiden Wörter eben die ersten beiden in der Kette der Gleichrangigen, ohne hierarchische Funktion.
Die Anarchie bedeutet nicht, dass im Text keine Ordnung wäre. Zunächst fällt der Buchstabe A auf, der den gesamten Text alphabetisch strukturiert – eine Ordnung, die sich gleichsam aus der Sprache selbst ergibt. Sodann soll auf die Auswahl der Textglieder geachtet werden.
Petrus Abaelard, der große und streitbare Philosoph und Theologe des Mittelalters, eröffnet diese Sequenz. Das lässt eine Streitschrift erwarten, Unnachgiebigkeit und Disput bereits in der Überschrift. Aber Abaelard wird zusammen mit Heloise genannt, deren Privatlehrer er war, und die er liebte. Als sie ein Kind erwartete, sollten sie getrennt werden. Doch Abaelard gelang es, sie zu heiraten. Beide gerieten unter Druck, Heloise kam im Kloster unter, Abaelard wurde entmannt. Später betreute er Heloises Klostergemeinschaft spirituell, was ihm wieder Feinde machte.
Somit steht Rühms Fragment unter dem Zeichen von Liebe und Konflikt, von Spannung und Anziehung, Freude und Missgunst. Es ist deutlich ein Beziehungszeichen, und zwar aus der Welt des Denkens und Glaubens. Mehrere Nennungen fügen sich in diese so eröffnete Reihe, Aischylos, die Literaturgeschichte, Sein oder Nichtsein, Aristoteles, die Poetik, Augustinus und seine Bekenntnisse – diese mehrfach, sowohl im Sinne des Glaubenskampfes, des großen Denkers, wie auch durch die dort bezeugte spannungsreiche Liebesbeziehung.
Mehrere Nennungen beziehen sich auf Goethe und die deutsche romantische Dichtung. Aber es gibt auch Anspielungen auf den Wiener Aktionismus der Nachkriegsjahrzehnte, zu dessen Vertretern Rühm selbst gehört, sowie der gleich anfangs genannte Friedrich Achleitner, womöglich noch origineller als Rühm selbst, auch heute noch. Der Werwolf mag auf H.C. Artmann anspielen und seine Vampirgeschichten, ebenso wie die Kleinschrift und die alphabetische Reihung. Rühm ist Komponist, Sprachdichter und arbeitet mit Gestik und visueller Kunst. Sein anarchischer Ansatz, der bereits im Buchtitel >LÜGEN ÜBER LÄNDER UND LEUTE< aufscheint, öffnet ein Feuerwerk von Ideen und Anfängen, ohne dass es respektlos und selbstgerecht würde. Rühm kennt und nennt seine Voraussetzungen und Vorläufer, das Zitat ist ein selbstbewusstes Element seiner Texte, die Anspielungen klug und wohlgesetzt. Wenn jemand fragt, worauf er denn mit seinem Text hinauswolle, so wird sich schon eine präzise Antwort finden.
Oswald Wiener, von dem der vierte heute vorzustellende Text stammt, obwohl er nicht in der Aussendung stand, weil er nicht mehr lieferbar ist, habe ich vor einigen Jahren bei einem Vortrag an der Uni Klagenfurt erlebt, und war enttäuscht. Viel witziger und hintergründiger schienen mir seine Texte und Aktionen, als der etwas steife und ungelenke stattliche Herr, der ohne jede Spur von Ironie oder Hintergründigkeit über künstliche Intelligenz referierte. Das erste, was ich von Wiener kannte, war sein Text über den Bio-Adapter. Das ist eine Glücksmaschine, an die der Mensch angeschlossen wird, und die nach und nach seine körperlichen und geistigen Funktionen übernimmt. Damals studierte ich fürs Lehramt Biologie und Deutsch und hatte noch keine Ahnung von Computern und Handys, von Google und Satellitennavigation. Aber die Warnung, durch Technik den Menschen überhaupt über-flüssig zu machen, erschien mir sehr begründet, zumal sie von dem Bürgerschreck, Philosophen und Kreativgenie stammte. DIE VERBESSERUNG VON MITTELEUROPA, ROMAN führt Sprachkritik vor auf einem, ich würde sagen, exzessiven Niveau, mindestens ebenso radikal wie die bisher vorgetragenen Stücke, und dazu in einem fröhlichen und rücksichtslosen Ton, ohne je zu zögern, jederzeit die Probe des Behaupteten bei sich selbst zu machen, also mit einem zutiefst existenziellen Bezug. Hören Sie ein recht willkürlich ausgewähltes Fragment:
die zivilisationserscheinung des lachens.
sprache ist alles, was bedeutung vermuten lässt, (eigens für die theologie formuliert die welt eine meinung gottes, sie beweist ihn indem sie die welt zu einer sprache erklärt,) und sinn mutmassen heisst die sinnlichkeit degradieren.
das lachen bedarf der sprache und ihrer suggerierten endgültigkeit.
fernöstliche ökonomie, wie sie so oft mit abstraktion verwechselt wird, gibt einem witz sein kolorit; die pointe aber ist eine vernichtung der situation durch eine analogie, die ziellos bleibt und induktion verbietet. der eingestimmte hörer, er ist ja besten willens, belacht die beschränktheit seiner eigenen konzentrierten auffassung, verständnislos und doof weilt der asket.
das paradoxon allein ist komisch und bringt, als ungefährliches wunder, kindlichen gästen entladung.
witzig ist die unbesehene analogie, die unverbindlich angedeutete ersatzsituation, letztlich die erkenntnis.
das witzwort ausserhalb der ihm zugedachten situation ist unlustig wie letztere an sich, so weit so gut. wer schneller denkt, lacht aber neuerdings über die beschreibung allein, herzlich.
der spiesser nimmt den witz nicht ernst, lehnt dessen kongruenzverfahren nicht ab, obwohl es sich ausdrücklich nur auf momente beschränkt: der spiesser gestattet sich den witz, weil er ihn für ein spiel hält. je nun – es ist aber jegliche erkenntnis erheiternd; was uns verstummen lässt ist die verbindlichkeit, die usupatorische verallgemeinerung. ernst macht mich, dass .
Der Wittgenstein´sche Ansatz wird sogleich gebrochen am Lachen, das möglicherweise eine Welterschließung jenseits der Sprache gewährt, die ja beschränkt ist. Aber zugleich sind Lachen und Witz jederzeit dazu angetan, den Spießer bloßzustellen. Einerseits führt Wiener eine Souveränität der Sprachbeherrschung vor, indem er an ihren Grenzen entlang navigiert und in einem fort Ebenen überspringt zwischen Fachvokabular, Nihilismus und Erzählung, insbesondere indem er vorgibt, etwas Bestimmtes zu sagen, eine Erkenntnis zu präsentieren und dem Leser/Hörer mit Bestimmtheit vorzusetzen. Doch andererseits besteht gerade sein Manöver darin, die Unmöglichkeit der verbindlichen Aussage über die Welt vorzuführen. Bemerkenswert, dass selbst dieser verquere Aphorismus übers Lachen nicht ohne Theologie auskommt. Ich könnte mühelos die Darstellung der Welt als Meinung Gottes als Zitat aus Musils Mann ohne Eigenschaften belegen, der bestimmt in Wieners Reichweite ist – möchte aber meinem Vorsatz treu bleiben, endlich einmal einen Vortrag ohne Musil zustandezubringen. So verweise ich auf Augustinus, der die Welt mit den Gedanken Gottes zusammenbringt, und bin ebenso wieder bei der Sprache gelandet.
Was mich von jeher faszinierte am Wiener Aktionismus, war diese Einheit von Kunst und Existenz, ja eigentlich ist diese seltsame, ausschweifende Form der Künstlergruppe zugleich Existenz und Kunst. Deshalb sind Texte und Filme, Aktionen und Malerei, Musik und Kabarett, Architektur und Wissenschaft nur verschiedene Kanäle desselben unbändigen Hervorbrechens eines neuen Denkens. Die Welt neu zu sehen, neu zu denken und neu zu schaffen, war gewiss nach dem Krieg und der darauf folgenden Dumpfheit sehr nötig, aber dieses Ereignis ist nicht nur ein regionales, sondern markiert einen Übergang, wie er weiter oben von einer anderen Seite bereits beschrieben wurde. Ich habe von diesem Übergang vielleicht einen anderen Begriff als Ossi Wiener und der Aktionismus, bin aber nichtsdestotrotz davon überzeugt, dass er gemacht werden muss. Neidvoll habe ich immer auf dieses Kollektiv hingeschaut, das Politisches Kabarett macht und Performances veranstaltet, ein Team aus lauter Individualisten, das frech einen neuen Sinn einführt und in vielem bis heute richtungsweisend wurde, z.B. in der Literatur und im Experiment. Wenn Sie mich nicht verraten, dann gestehe ich an diesem unverdächtigen Ort, dass ich ja deshalb Priester geworden bin, um kreative Talente aufzuspüren und Aktionskanäle zu erweitern, und ich bin guter Dinge, dass vielleicht aus dieser Pfarrgemeinderatswahl nun das geniale kreative Team hervorgehen wird.
Und somit verspreche ich, heute nichts über Kondylis zu sagen, obgleich es sich um ein brillantes und leider nur in Fachkreisen bekanntes Buch handelt. Wahrscheinlich hat Kondylis das auch selbst so gewollt, denn er hat sich konsequent aus dem akademischen Wissensbetrieb herausgehalten, so konsequent, wie ich das sonst nie gesehen habe. Man stelle sich vor, 300 Seiten über die Ideen- und Motivgeschichte des Bürgertums zu schreiben, ohne ein einziges Werk, einen Künstler, Wissenschaftler, Politiker oder ein Datum zu nennen! Natürlich erhöht das weder Verständlichkeit noch Lesevergnügen, abgesehen von einem gewissen detektivischen Reiz, den es hat, Andeutungen zu folgen und sich falsche oder richtige ungenannte Autoren oder Werke vorzustellen. Außerdem disqualifiziert sich das Werk ja bereits durch seinen Titel, denn was soll an einem Bürgertum noch interessant sein, wenn es angeblich bereits untergegangen ist. Wahrscheinlich muss das Buch selbst zu dem darin konstruierten Phänomen gerechnet werden, dessen Erscheinen und Verschwinden auf hunderten Seiten ausgebreitet wird, ohne ein einziges Faktum zu nennen. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass ich dieses Buch auch niemals besessen habe, denn es war seit Jahrzehnten vergriffen, und die jüngste Neuauflage erschien zu einem stattlichen Preis.
Bei Formulierungen wie der folgenden denke ich unwillkürlich an bestimmte Menschen, deren Lebenshaltung mich zugleich fasziniert wie auch abgestoßen hat, ohne dass ich das damals, als Schüler und Student, noch einer bestimmten sozialen und ideologischen Figur wie dem Bürgertum hätte zuordnen können. Aber hören Sie selbst:
„Derselbe Wunsch, Natur und Vernunft, Geist und Materie, Norm und Trieb im Rahmen eines übergreifenden harmonischen Ganzen miteinander in Einklang zu bringen, beflügelt die bürgerliche Anthropologie. Das Harmonisierungsbestreben, das auf ontologischer Ebene in der doppelten Abgrenzung gegen den Dualismus und den Monismus bzw. den Spiritualismus und den Materialismus gründete, entstand im Bereich der Anthropologie aus der doppelten Abneigung gegen das restlose Aufgehen des Menschen in der materiellen Natur und gegen eine solche Erhebung über die Natur, dass er nur im Himmel seine wahre Heimat finden könnte. (...) Die Auffassung, der Mensch herrsche kraft seiner Vernünftigkeit über die eigene Natur, hing freilich auch eng mit der Überzeugung von der Beherrschbarkeit der äußeren Natur und dadurch mit der modernen Naturwissenschaft und dem Glauben an die Naturgesetzmäßigkeit zusammen.“ (30)
Ich habe in jugendlichem Alter solche Haltungen, die mir in imposanten Persönlichkeiten, z.B. einem Priester und Religionslehrer, begegnet sind, für lauwarm und inkonsequent gehalten. Dennoch hat gerade er mir Kirche und Glauben mit Nachdruck unter die Nase gerieben. Jüngst habe ich sein Gedenkbild wiederentdeckt, auf dem er stolz vermerkt: „Kirchliche Auszeichnungen: Keine. Auszeichnung durch einen Jugendlichen: Wenn sogar du in dieser Kirche bist, dann bleibe ich auch!“ Der hier bezeugte Gegensatz zwischen einer starken Präsenz bei Menschen und einem theologischen Konservativismus, bestimmten mein Kirchenbild in jungen Jahren, eigentlich bis zum Theologiestudium. Es war kein Darum-Glauben, sondern eher ein Trotzdem-Glauben. Auch die Rede von der Naturliebe machte mich misstrauisch. Vielleicht sind die am Plan abgehakten Wanderwege eher ein Instrument der Herrschaft und Selbstbestätigung. Die Art von Vernunft, die mir damals von der älteren Generation begegnete, schien mir überaus interessengeleitet zu sein, und was daran sich als religiös gab, war wenig glaubhaft.
„In der Geschichte entfaltet oder aktualisiert sich die menschliche Natur – und der Versuch, in jener Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen oder dem Einfluss materieller Faktoren, von den geographischen bis zu ökonomischen, auf die Spur zu kommen, entsprang im bürgerlichen Denkrahmen nicht so sehr der Wunsch, die menschliche Autonomie zu relativieren, sondern eher der Absicht, den unberechenbaren Einmischungen Gottes in das Weltgeschehen ein Ende zu setzen. (...) Der bürgerliche Evolutionismus (...) bildete den Gegenbegriff zum theologischen Fixismus, der seinerseits den Ewigkeits- und Unveränderlichkeitsanspruch der societas civilis in den Kosmos hineinprojizierte. In der bürgerlichen Vorstellung paarte sich indes die Idee des Fortschritts und der Entwicklung mit der Idee der Ordnung“ (33)
Somit erschien mir das Streben nach Beherrschung der Natur, auch der eigenen, z.B. mit Hilfe der Vorstellung Freuds von der Triebökonomie, indem man sich gerne kleine Laster gestattet zugunsten der Ablenkung von stärkeren Bedürfnissen, als wenig überzeugend. Die Abdrängung Gottes zu einem Wunderwirker in beschränktem Rahmen konnte ich zwar als Argumentationsfigur anwenden, aber wirkliche Erkenntnis erwartete ich davon nicht. Mein Gefühl warnte mich davor, mich einem solchen wohlgeteilten Bürgerhimmel zu verschreiben, wie mir auch für meine Wohnung und meinen Tagesablauf übertriebene Ordnung verdächtig war, und mich stets mehr das Unvorhergesehene interessierte, und das, was aus der Reihe trat. Mein Kampf gegen die bürgerliche Weltvermessung wurde auf Radtouren und Reisen per Anhalter ausgetragen, und die Benützung des Privatautos von Einzelpersonen trotz möglicher Alternativen erscheint mir bis heute als unmoralisch und engstirnig. Wahrscheinlich habe ich deshalb nicht in den vorgesehenen Lebensjahrzehnten geheiratet und eine Familie gegründet, sondern bin Vagabund geworden.
Aber solche Konsumgewohnheiten sind nach Kondylis eigentlich als nachbürgerlich zu betrachten, obwohl sie unzweifelhaft die ehedem bürgerlichen Anliegen darstellen, nur dass sie inzwischen einer Masse zugänglich geworden sind, in die hinein die historische Formation des Bürgertums sich inzwischen aufgelöst hat. Und während meine Generation immer noch den vermeintlich heroischen Kampf der 68er gegen das System hochhält, breitet Kondylis ein Beispiel um das andere aus, um den Übergang vom bürgerlichen Wertekanon zum massendemokratischen Konsumkanon zu beschreiben als die gesellschaftliche Durchsetzung der früheren bürgerlichen Anliegen.
„Die Abschaffung des bürgerlichen Bildungskanons geht ... mit dem Kampf gegen die Autorität und mit dem Bestreben einher, Spontaneität und Kreativität als Voraussetzungen für die Selbstverwirklichung zu entwickeln. (...) Wir meinen die grundsätzliche soziale Nivellierung der Altersstufen, die genauso wie die angestrebte Beseitigung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern aus dem Aufstand des Egalitarismus gegen die Biologie folgen muss. (...) Vor diesem Hintergrund entsteht der massendemokratische Kult der Jugend und der Jugendlichkeit, dem die Älteren ständig Rechnung tragen müssen, indem sie sich mit unterschiedlichem Erfolg bemühen, möglichst lange fit zu bleiben....“ (220)
Man sieht, wie sich die Aufklärungsideale vom freien Subjekt durchgesetzt haben in der modernen Massendemokratie – ein Leitbegriff bei Kondylis – für die Selbstverwirklichung zum Dogma geworden ist. Die Freiheitsforderung geht so weit, einerseits völlige Angleichung aller zu fordern: der Männer, Frauen, Jugendlichen, Kinder, Senioren, Reichen, Armen, und sowohl Forderung wie auch Umsetzung durch dem Massenkonsum von Gütern zu gewährleisten. Frauen, Kinder und Senioren traten deshalb ins Rampenlicht, weil sie als Konsumenten gebraucht wurden am bereits gesättigten Markt. Andererseits geht die Freiheitsforderung der anspruchsvoll gewordenen Konsumenten auch gegen die eigene Natur. Empfängnisverhütung und Abtreibung, Lebensverlängerung, künstliche Befruchtung, Manipulation am Erbgut oder Neubewertung von Homosexualität haben den Menschen mehr Verfügung über die Natur gebracht, aber auch viele neue Probleme und Fragen.
Es ist wohl das, was mich an Kondylis´ Untersuchung so beeindruckt hat, dass der Zusammenhang zwischen bürgerlichen Einstellungen, liberal oder konservativ, mit heutigen Konsumhaltungen und ihrem ungeniert zur Schau getragenen Hedonismus so klar nachgezeichnet wird. Ich beginne zu verstehen, wie noch so konservativ eingestellte Persönlichkeiten zugleich ohne jede Zurückhaltung sich modernster Konsumartikel bedienen und jeden Trend mitmachen können, ohne das als Widerspruch zu empfinden.
Was noch aussteht, und das interessiert mich ja stets am meisten, ist die Neubewertung der Rolle, die Bürgertum und bürgerliche Haltungen und Werte in der Kirche spielten und heute spielen. Ich frage nach der bürgerlichen Theologie, für die Kants Schrift „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ vielleicht ein Schlüsselwerk war, und nach ihren philosophischen und gnostischen Verästelungen bis zur Esoterik, jeweils im Horizont der abendländischen Kirchenspaltung durch den Protestantismus. Die Pole bürgerlicher Religion, der Deismus und der Pantheismus, sind wahrscheinlich Voraussetzungen und zugleich Begleitumstände der aufkommenden Naturwissenschaft, die nach wie vor regelmäßig Weltdeutungen produziert, ohne dass diese kirchlich wahrgenommen oder beantwortet würden. Zugleich ist auch unser Kirchenbetrieb selbst von bürgerlichen Interessen durchzogen, die als kirchlich erscheinen und in einem fort Machtkämpfe generieren, und vielleicht ist ein Leben aus dem Glauben gar nicht anders als mit einem bürgerlichen Schatten vorstellbar. Hat jemand dazu eigentlich schon einmal die heilige Schrift befragt?
Nun möchte ich mich einer womöglich noch sonderbarer und eigenwilliger Buch-Erscheinung zuwenden, nämlich Josef Mitterers „Die Flucht aus der Beliebigkeit“. Der Philosophieprofessor an der Klagenfurter Universität führt auf knapp 200 Seiten und in 160 Paragraphen vor, in welcher Beliebigkeit philosophisches Denken, und Denken und Argumentieren überhaupt, sich bewegt, und wie alle erreichten Positionen, als Rationalismus und Empirismus, Konstruktivismus und Dekonstruktivismus usf, stets nur das für sich in Anspruch nehmen können, dass ihre Vertreter sie eben vertreten. Die dargestellten Richtungen erscheinen als Glaubensrichtungen, die sich jeweils im Besitz der Wahrheit sehen, und untereinander dogmatisch argumentieren. Warum aber jemand eine bestimmte philosophische Auffassung vertritt, liegt nach Mitterer an dessen Biographie, wer seine Lehrer waren, und wo er studiert hat, und nicht an der Wahrheit der Auffassung, denn diese ließe sich niemals gültig darstellen gegenüber anderen Positionen. In lakonischem Stil führt er das seitenweise vor, mit einfachsten Beispielen und ohne Fachvokabular. Alle großen philosophischen Fragen erweisen sich solcherart als ungelöst, und man kann staunen über den großen Aufwand, der über Jahrtausende betrieben wurde ohne gültige Ergebnisse.
Es geht Mitterer dabei um das, was allen philosophischen Denkschulen gemeinsam ist, nämlich dass sie zwischen der Welt und dem Diskurs über die Welt unterscheiden. Er nennt das dualistische Redeweise. Sie findet sich in der Gegenüberstellung von Sein und Denken, Subjekt und Objekt, Idee und Wirklichkeit, Sprache und Sein, Wort und Ding. Indem zur Welt das Reden über die Welt gesetzt wird, entsteht ein Entsprechungsverhältnis. Diese Entsprechung kann zutreffen oder nicht zutreffend sein, wahr oder falsch. Auf der Ebene des Redens entstehen nun Methoden und Regeln, die eine wahre Aussage von einer falschen unterscheiden. Dabei versucht jede Argumentation, im Reden die Sprachebene zu verlassen und die Ebene der Wirklichkeit zu erreichen. Dieser Übergang ist der Wahrheitsdiskurs. Nur, so Mitterer, sei das Problem des Übergangs eben ein Folgeproblem des dualistischen Denkens, und auf langen Seiten führt er das mit immer neuen Ansätzen und Beispielen als zirkulären Vorgang vor, bis dem Leser schwindelt und er sich zu fragen beginnt, ob denn da kein Ausweg ist aus dem Strudel.
Er mag sich erinnern an die Sprachkritik des frühen Wittgenstein, die Elementarsätze fordert zur genauen Wiedergabe der Tatsachen, und andere Reden zurückweist, oder an die Sprachspiele des späten Wittgenstein. Mitterer verleugnet diese Verwandtschaft nicht. Aber zeigt nicht gerade Wittgenstein die Parallelität zwischen Sprache und Sein erst recht? Näher verwandt erweist sich sein Denken mit dem Konstruktivismus, aber auch diesen überführt er in einem eigenen Anhang des dualistischen Denkens. Weniger aufmerksam scheint die Kritik an Mitterer für dessen Verbindung zu erkenntnistheoretischen Positionen Nietzsches zu sein. Dessen berühmter Aphorismus 22 aus Jenseits von Gut und Böse führt die Wissenschaft vor, die Naturgesetze findet und zu Tatsachen erklärt. Er bestreitet, dass die Objekte der Wissenschaft der Text wären, den sie rekonstruiert, und von dem sich durch Interpretation und Ableitung die moderne Technik und Lebensweise gewinnen ließe. Der Tatsachentext, der Kult des Faktischen, sei selbst Interpretation, so Nietzsche, und der gesuchte Boden des Faktischen, auf dem wir stehen, bloßes Wunschdenken. Er nennt das den zweiten Atheismus, den entmachteten Glauben an die Naturgesetze.
Nietzsche öffnet in dieser erkenntnistheoretischen Grundsatzdiskussion das Tor zur existenziellen Dimension. Er könnte beinahe als der Entdecker der interessensgeleiteten Argumente gelten, der aufzeigt, was es jemand nützt, so oder so zu denken und zu argumentieren. In seiner Genealogie der Moral hat er das mit Nachdruck ausgeführt. Er gibt uns damit einen Fingerzeig zurück zum eingangs untersuchten Bürgertum und seiner Geisteshaltung. So soll also nun Mitterer nach seiner eigenen Position befragt werden, da ja nach dessen Dekonstruktion der Philosophiegeschichte schwer noch eine von dessen Kritik ausgenommene Position denkbar bleibt. Er nennt in einer Handvoll Paragraphen eine Nichtdualisierende Rede, die die genannten Probleme unterlaufen könne.
„Nichtdualisierendes >>Reden über<< ist nicht mehr auf das Objekt der Rede gerichtet, sondern geht vom Objekt der Rede aus. Über ein Objekt reden heißt die Rede so far in einer Rede from now on fortführen.“, sagt Josef Mitterer in Paragraph 157. Solcherart wird darauf verzichtet, einen Wahrheitsanspruch einzuführen und die Gültigkeit der eigenen Aussage zu untermauern. Stattdessen stellt Mitterer das Prinzip der Interpretation heraus, dass sie nämlich später ist als das Interpretierte. Der Unterschied zwischen den Aussagen liegt nicht in ihrer metaphysischen Ableitung, sondern im Zeitpunkt der Rede. Der den früheren interpretiert und dessen Rede über das Objekt fortführt, hat recht – bis ein anderer seine Rede wieder interpretiert. So ist die Rede über das Objekt selbst als Objekt begriffen, und fällt mit ihm zusammen. Damit ist der bisherige Wahrheitsbegriff obsolet, und die Aussagen erscheinen alle gleichwertig und auf der gleichen Ebene. Die einzig relevanten Unterschiede liegen nicht in einer Rangordnung oder Abbindung an Unbestreitbares, sondern bloß in der Reihenfolge. Das ist sozusagen ein demokratischer Wahrheitsbegriff, der es nicht nötig hat, ein Jenseits des Diskurses zu behaupten, sei es eine Wirklichkeit oder ein Ding an sich oder eine Idee.
Wenn es dabei bleibt, welche Folgen hätte ein solches Wahrheitsverständnis für unser Leben, und im besonderen für die theologische Rede? Autoritäten wie Eltern oder Lehrer hätten es dann noch schwerer, denn die Geltung ihrer Rede könnte noch weniger als bisher von ihrer Position abgeleitet und begründet werden. Der Zögling könnte jederzeit sagen: Ich interpretiere deine Rede und das, wovon du redest, anders, und meine Aussage gilt from now. Leichter aber hätten es die Prediger. Denn sowohl das jeweilige Schriftwort wie auch alle bisherigen Interpreten könnten jederzeit in freiem Sinne in eine neue Rede hineingestellt werden, sodass jede Predigt eine Zeitenwende sein möge, wie auch Jesus es verstanden hat, der sagte: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist... / ich aber sage euch: ....
Man sieht sogleich, dass der neue Wahrheitsbegriff, auf den Mitterer zugeht, mit der Persönlichkeit zusammenhängt, der ihn vertritt, und mit seinem Geist. Die Behelfe können auf Dauer nicht vor falscher Rede schützen, die Person muss als überzeugend erfahren werden, der Erweis liegt in der Präsenz der Person. Und wenn es strittig sein mag, wer nun recht hat: nun, so warten wir eben auf den, der danach kommt und redet. „Gesetzt, dass auch dies nur Interpretation ist – und ihr werdet eifrig genug sein, dies einzuwenden? – nun, umso besser.“ (Jenseits von Gut und Böse, Aph 22)
Die Wendezeit, die sich, wenn schon nicht bei Kondylis oder Mitterer, so doch zumindest in meiner Interpretation abzeichnet, wie sie mit den Wendungen so far/from now markiert ist, spielt, wie man bemerken wird, bei meiner Literaturwahl eine große Rolle. Dabei gebe ich nicht allein der Zeit und ihrer Texte die Schuld, sondern bin bereit und gefasst, auch das Lesen selbst gebührend in die Pflicht zu nehmen. Eine Art Lesens wie das vorgestellte vermag ja überall, Wendezeichen zu finden, oder das Lesen wendet selbst die Zeichen, bis ein neuer Sinn erkennbar wird. So gestehe ich unumwunden, dass selbige Ergebnisse auch aus jeglicher anderer Literatur gezogen hätten werden können, sodass die schließlich erzielte Auswahl sich mehr pragmatischen Erwägungen verdankt, wie der Verfügbarkeit der Texte (bis auf einen), ihr jüngeres Erscheinungsdatum, oder auch bloß die Quantität der Zeit und Interpretationen, die ich mit ihnen verbrachte. So würde ich gerne versuchen, einen Textauszug von Gerhard Rühm mit Ihnen gemeinsam zu untersuchen, um darauf zu achten, was in einem solchen Text liegen mag oder was wir Leser darin finden wollen:
ABAELARD UND HELOISE
achleitner. eisenbahnstreik. aeschylos. sämtliche dramen. albrecht. abriss der römischen literaturgeschichte. albumblätter. alexis. die hosen des herrn bredow. cabanis. der roland von berlin. der werwolf. der falsche woldemar. andersen. bilderbuch ohne bilder. glückspeter. der improvisator. nur ein geiger. sämtliche märchen. sein oder nichtsein.
anschütz. erinnerungen aus dessen leben und wirken. griechische anthologie. apel und laun. gespensterbuch. archenholtz. geschichte des siebenjährigen krieges. ariosto. rasender roland. aristoteles. die poetik. verfassung von athen. arndt. erinnerungen. gedichte. wanderungen mit stein. bettina von arnim. goethes briefwechsel mit einem kinde. arnim-brentano. des knaben wunderhorn. arnold. die leuchte asiens. augustinus. bekenntnisse,.
Ich würde diesen Textauszug gerne sogleich mit Ihrem Einverständnis als anarchistisch bezeichnen. Wie Sie jetzt nicht sehen können, schreibt Gerhard Rühm in radikaler Kleinschrift, das bedeutet, ohne jede Hierarchie im Schriftbild, kein Buchstabe vor anderen ausgezeichnet, alle vor Gott gleich. Das einzige verwendete Satzzeichen ist der Punkt. Damit sind alle Textteile ebenfalls gleichwertig nebengeordnet. Da kein Satz vorliegt, gibt es auch keinen Satzbau, welcher die Glieder in eine Ordnung zwingen würde. Zwar hat der mit mehreren Seiten längste Text des Buches eine Überschrift, aber diese fügt ihn bloß ins Buch ein, innerhalb des Textes sind die beiden Wörter eben die ersten beiden in der Kette der Gleichrangigen, ohne hierarchische Funktion.
Die Anarchie bedeutet nicht, dass im Text keine Ordnung wäre. Zunächst fällt der Buchstabe A auf, der den gesamten Text alphabetisch strukturiert – eine Ordnung, die sich gleichsam aus der Sprache selbst ergibt. Sodann soll auf die Auswahl der Textglieder geachtet werden.
Petrus Abaelard, der große und streitbare Philosoph und Theologe des Mittelalters, eröffnet diese Sequenz. Das lässt eine Streitschrift erwarten, Unnachgiebigkeit und Disput bereits in der Überschrift. Aber Abaelard wird zusammen mit Heloise genannt, deren Privatlehrer er war, und die er liebte. Als sie ein Kind erwartete, sollten sie getrennt werden. Doch Abaelard gelang es, sie zu heiraten. Beide gerieten unter Druck, Heloise kam im Kloster unter, Abaelard wurde entmannt. Später betreute er Heloises Klostergemeinschaft spirituell, was ihm wieder Feinde machte.
Somit steht Rühms Fragment unter dem Zeichen von Liebe und Konflikt, von Spannung und Anziehung, Freude und Missgunst. Es ist deutlich ein Beziehungszeichen, und zwar aus der Welt des Denkens und Glaubens. Mehrere Nennungen fügen sich in diese so eröffnete Reihe, Aischylos, die Literaturgeschichte, Sein oder Nichtsein, Aristoteles, die Poetik, Augustinus und seine Bekenntnisse – diese mehrfach, sowohl im Sinne des Glaubenskampfes, des großen Denkers, wie auch durch die dort bezeugte spannungsreiche Liebesbeziehung.
Mehrere Nennungen beziehen sich auf Goethe und die deutsche romantische Dichtung. Aber es gibt auch Anspielungen auf den Wiener Aktionismus der Nachkriegsjahrzehnte, zu dessen Vertretern Rühm selbst gehört, sowie der gleich anfangs genannte Friedrich Achleitner, womöglich noch origineller als Rühm selbst, auch heute noch. Der Werwolf mag auf H.C. Artmann anspielen und seine Vampirgeschichten, ebenso wie die Kleinschrift und die alphabetische Reihung. Rühm ist Komponist, Sprachdichter und arbeitet mit Gestik und visueller Kunst. Sein anarchischer Ansatz, der bereits im Buchtitel >LÜGEN ÜBER LÄNDER UND LEUTE< aufscheint, öffnet ein Feuerwerk von Ideen und Anfängen, ohne dass es respektlos und selbstgerecht würde. Rühm kennt und nennt seine Voraussetzungen und Vorläufer, das Zitat ist ein selbstbewusstes Element seiner Texte, die Anspielungen klug und wohlgesetzt. Wenn jemand fragt, worauf er denn mit seinem Text hinauswolle, so wird sich schon eine präzise Antwort finden.
Oswald Wiener, von dem der vierte heute vorzustellende Text stammt, obwohl er nicht in der Aussendung stand, weil er nicht mehr lieferbar ist, habe ich vor einigen Jahren bei einem Vortrag an der Uni Klagenfurt erlebt, und war enttäuscht. Viel witziger und hintergründiger schienen mir seine Texte und Aktionen, als der etwas steife und ungelenke stattliche Herr, der ohne jede Spur von Ironie oder Hintergründigkeit über künstliche Intelligenz referierte. Das erste, was ich von Wiener kannte, war sein Text über den Bio-Adapter. Das ist eine Glücksmaschine, an die der Mensch angeschlossen wird, und die nach und nach seine körperlichen und geistigen Funktionen übernimmt. Damals studierte ich fürs Lehramt Biologie und Deutsch und hatte noch keine Ahnung von Computern und Handys, von Google und Satellitennavigation. Aber die Warnung, durch Technik den Menschen überhaupt über-flüssig zu machen, erschien mir sehr begründet, zumal sie von dem Bürgerschreck, Philosophen und Kreativgenie stammte. DIE VERBESSERUNG VON MITTELEUROPA, ROMAN führt Sprachkritik vor auf einem, ich würde sagen, exzessiven Niveau, mindestens ebenso radikal wie die bisher vorgetragenen Stücke, und dazu in einem fröhlichen und rücksichtslosen Ton, ohne je zu zögern, jederzeit die Probe des Behaupteten bei sich selbst zu machen, also mit einem zutiefst existenziellen Bezug. Hören Sie ein recht willkürlich ausgewähltes Fragment:
die zivilisationserscheinung des lachens.
sprache ist alles, was bedeutung vermuten lässt, (eigens für die theologie formuliert die welt eine meinung gottes, sie beweist ihn indem sie die welt zu einer sprache erklärt,) und sinn mutmassen heisst die sinnlichkeit degradieren.
das lachen bedarf der sprache und ihrer suggerierten endgültigkeit.
fernöstliche ökonomie, wie sie so oft mit abstraktion verwechselt wird, gibt einem witz sein kolorit; die pointe aber ist eine vernichtung der situation durch eine analogie, die ziellos bleibt und induktion verbietet. der eingestimmte hörer, er ist ja besten willens, belacht die beschränktheit seiner eigenen konzentrierten auffassung, verständnislos und doof weilt der asket.
das paradoxon allein ist komisch und bringt, als ungefährliches wunder, kindlichen gästen entladung.
witzig ist die unbesehene analogie, die unverbindlich angedeutete ersatzsituation, letztlich die erkenntnis.
das witzwort ausserhalb der ihm zugedachten situation ist unlustig wie letztere an sich, so weit so gut. wer schneller denkt, lacht aber neuerdings über die beschreibung allein, herzlich.
der spiesser nimmt den witz nicht ernst, lehnt dessen kongruenzverfahren nicht ab, obwohl es sich ausdrücklich nur auf momente beschränkt: der spiesser gestattet sich den witz, weil er ihn für ein spiel hält. je nun – es ist aber jegliche erkenntnis erheiternd; was uns verstummen lässt ist die verbindlichkeit, die usupatorische verallgemeinerung. ernst macht mich, dass .
Der Wittgenstein´sche Ansatz wird sogleich gebrochen am Lachen, das möglicherweise eine Welterschließung jenseits der Sprache gewährt, die ja beschränkt ist. Aber zugleich sind Lachen und Witz jederzeit dazu angetan, den Spießer bloßzustellen. Einerseits führt Wiener eine Souveränität der Sprachbeherrschung vor, indem er an ihren Grenzen entlang navigiert und in einem fort Ebenen überspringt zwischen Fachvokabular, Nihilismus und Erzählung, insbesondere indem er vorgibt, etwas Bestimmtes zu sagen, eine Erkenntnis zu präsentieren und dem Leser/Hörer mit Bestimmtheit vorzusetzen. Doch andererseits besteht gerade sein Manöver darin, die Unmöglichkeit der verbindlichen Aussage über die Welt vorzuführen. Bemerkenswert, dass selbst dieser verquere Aphorismus übers Lachen nicht ohne Theologie auskommt. Ich könnte mühelos die Darstellung der Welt als Meinung Gottes als Zitat aus Musils Mann ohne Eigenschaften belegen, der bestimmt in Wieners Reichweite ist – möchte aber meinem Vorsatz treu bleiben, endlich einmal einen Vortrag ohne Musil zustandezubringen. So verweise ich auf Augustinus, der die Welt mit den Gedanken Gottes zusammenbringt, und bin ebenso wieder bei der Sprache gelandet.
Was mich von jeher faszinierte am Wiener Aktionismus, war diese Einheit von Kunst und Existenz, ja eigentlich ist diese seltsame, ausschweifende Form der Künstlergruppe zugleich Existenz und Kunst. Deshalb sind Texte und Filme, Aktionen und Malerei, Musik und Kabarett, Architektur und Wissenschaft nur verschiedene Kanäle desselben unbändigen Hervorbrechens eines neuen Denkens. Die Welt neu zu sehen, neu zu denken und neu zu schaffen, war gewiss nach dem Krieg und der darauf folgenden Dumpfheit sehr nötig, aber dieses Ereignis ist nicht nur ein regionales, sondern markiert einen Übergang, wie er weiter oben von einer anderen Seite bereits beschrieben wurde. Ich habe von diesem Übergang vielleicht einen anderen Begriff als Ossi Wiener und der Aktionismus, bin aber nichtsdestotrotz davon überzeugt, dass er gemacht werden muss. Neidvoll habe ich immer auf dieses Kollektiv hingeschaut, das Politisches Kabarett macht und Performances veranstaltet, ein Team aus lauter Individualisten, das frech einen neuen Sinn einführt und in vielem bis heute richtungsweisend wurde, z.B. in der Literatur und im Experiment. Wenn Sie mich nicht verraten, dann gestehe ich an diesem unverdächtigen Ort, dass ich ja deshalb Priester geworden bin, um kreative Talente aufzuspüren und Aktionskanäle zu erweitern, und ich bin guter Dinge, dass vielleicht aus dieser Pfarrgemeinderatswahl nun das geniale kreative Team hervorgehen wird.
weichensteller - 22. Mär, 17:38