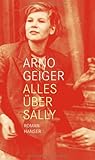Von Menschen und Gott
Endlich einmal ein guter, einfühlsamer wie auch intelligenter und kritischer Film, der christliches Leben thematisiert. Abseits der Klischees, die Kirche würde sich vorwiegend mit Zölibatsdiskussionen oder Machtfragen beschäftigen und damit, was jemand darf und was nicht, und jenseits der Vorurteile, christliches und gar mönchisches Leben sei weltfremd und ahnungslos, wird aber gerade diese radikale Weise der Christusnachfolge sehr natürlich und schnörkellos dargestellt.
Ein Kloster bei einem Dorf, französische Mönche im algerischen Atlasgebirge. Szenen selbstverständlicher Alltäglichkeit. Der Bruder am Traktor, Furchen ziehend. Er und eine junge Frau aus dem Dorf, die behutsam Zwiebeln setzen in die Furchen. Der andere Bruder, der das Kind in den Armen schaukelt und den Abszess am Kopf als ungefährlich erklärt, und den verschämten Blick der Mutter schließlich richtig deutet, dass ihr Schuhwerk zerschlissen ist und sie neue Schuhe braucht. Der junge Algerier, der frühmorgens die leeren Gassen hinaufeilt und im Kloster bei Maurerarbeiten hilft. Die junge Frau, die dem alten Mönch von ihrer Liebe erzählt, während ihr Vater einen andern für sie zum Mann bestimmt hat.
Dieses Tagewerk ist von einer Brüderlichkeit getragen, die nachsichtig ist gegen menschliche Schwächen, die durchaus wahrgenommen werden – und die auf sehr natürliche Weise beide im Dorf vertretenen Religionen umspannt, Moslems wie Christen. Die Mönche bei islamischen Feiern, die Moslems im Kloster, wie Nachbarn, die einander besuchen. Respekt und Fröhlichkeit, Ernst und Wertschätzung.
Der Rhythmus der Tage aber ist die Liturgie. Gottesdienste der acht Männer in Schlichtheit und Ernst, eine einfache Kirche, Gesänge, Verbeugungen, Stille, Gebet, nach innen gekehrt oder offen, als sprächen sie miteinander. Gerade diese Bilder zeigen: Der Mensch braucht gar nichts anderes. Wenn wir eilige Menschen bereits Unruhe emporkochen fühlen und uns umsehen, was wir versäumen könnten, sind diese Männer noch immer beim Zuhören, und wir können feststellen: es genügt. Es gibt nicht mehr.
Als dann Gewalt auftaucht, als die Bedrohung islamistischer Banden auch im Dorf und im Kloster greifbar wird, da beginnt sich gerade das zu erweisen, was diese acht Männer hält. Und abseits des politischen Hintergrundes, abseits der nun aufkommenden Dramatik, die so im Gegensatz zur vermeintlichen Idylle steht, tritt nun nach und nach eine Männlichkeit und Entschiedenheit hervor, die schließlich in aller Gefasstheit der Gewalt und Gottlosigkeit, dem geschenkten Vertrauen und dem Tod ins Auge blickt. Zunächst zeigt sich das in einer Führungsdiskussion. Dann geht es um den Umgang mit der Angst. Und indem die Männer in großer Freiheit und Ehrlichkeit ihre Alternativen bedenken, eine Rückkehr nach Frankreich, eine Aufgabe des geistlichen Lebens, ein Annehmen militärischer Hilfe durch die Regierung, da verstehen sie erst so richtig, warum sie Mönche und Geistliche sind. „Wir haben unser Leben doch bereits Gott geschenkt“, sagt einer von ihnen. Leben wollen sie alle – aber nicht mit Kalkül, sondern aus Gottes Hand. Genau das ist die Alternative.
Eine der stärksten Szenen ist, als die Islamisten ins Kloster eindringen und den Bruder Arzt holen wollen, um ihre Verwundeten zu versorgen. Der Abt tritt ihm entgegen und setzt ihm auseinander, dass das nicht möglich ist. Er spricht die Sprache des Bandenführers, und er argumentiert mit dem Koran, den er auswendig zitierten kann. So lässt sich der, an dessen Händen Blut Unschuldiger klebt, überzeugen. Dieser feste Blick, diese Klarheit, diese Entschiedenheit und Klugheit: das stammt aus einem geistlichen Leben, aus dem Ringen mit großen Fragen, getragen von einer großen Liebe. Das kann man nicht abtun mit einer beiläufigen Klassifizierung von Märtyrern. Das besteht in jeder Welt.
Ein Kloster bei einem Dorf, französische Mönche im algerischen Atlasgebirge. Szenen selbstverständlicher Alltäglichkeit. Der Bruder am Traktor, Furchen ziehend. Er und eine junge Frau aus dem Dorf, die behutsam Zwiebeln setzen in die Furchen. Der andere Bruder, der das Kind in den Armen schaukelt und den Abszess am Kopf als ungefährlich erklärt, und den verschämten Blick der Mutter schließlich richtig deutet, dass ihr Schuhwerk zerschlissen ist und sie neue Schuhe braucht. Der junge Algerier, der frühmorgens die leeren Gassen hinaufeilt und im Kloster bei Maurerarbeiten hilft. Die junge Frau, die dem alten Mönch von ihrer Liebe erzählt, während ihr Vater einen andern für sie zum Mann bestimmt hat.
Dieses Tagewerk ist von einer Brüderlichkeit getragen, die nachsichtig ist gegen menschliche Schwächen, die durchaus wahrgenommen werden – und die auf sehr natürliche Weise beide im Dorf vertretenen Religionen umspannt, Moslems wie Christen. Die Mönche bei islamischen Feiern, die Moslems im Kloster, wie Nachbarn, die einander besuchen. Respekt und Fröhlichkeit, Ernst und Wertschätzung.
Der Rhythmus der Tage aber ist die Liturgie. Gottesdienste der acht Männer in Schlichtheit und Ernst, eine einfache Kirche, Gesänge, Verbeugungen, Stille, Gebet, nach innen gekehrt oder offen, als sprächen sie miteinander. Gerade diese Bilder zeigen: Der Mensch braucht gar nichts anderes. Wenn wir eilige Menschen bereits Unruhe emporkochen fühlen und uns umsehen, was wir versäumen könnten, sind diese Männer noch immer beim Zuhören, und wir können feststellen: es genügt. Es gibt nicht mehr.
Als dann Gewalt auftaucht, als die Bedrohung islamistischer Banden auch im Dorf und im Kloster greifbar wird, da beginnt sich gerade das zu erweisen, was diese acht Männer hält. Und abseits des politischen Hintergrundes, abseits der nun aufkommenden Dramatik, die so im Gegensatz zur vermeintlichen Idylle steht, tritt nun nach und nach eine Männlichkeit und Entschiedenheit hervor, die schließlich in aller Gefasstheit der Gewalt und Gottlosigkeit, dem geschenkten Vertrauen und dem Tod ins Auge blickt. Zunächst zeigt sich das in einer Führungsdiskussion. Dann geht es um den Umgang mit der Angst. Und indem die Männer in großer Freiheit und Ehrlichkeit ihre Alternativen bedenken, eine Rückkehr nach Frankreich, eine Aufgabe des geistlichen Lebens, ein Annehmen militärischer Hilfe durch die Regierung, da verstehen sie erst so richtig, warum sie Mönche und Geistliche sind. „Wir haben unser Leben doch bereits Gott geschenkt“, sagt einer von ihnen. Leben wollen sie alle – aber nicht mit Kalkül, sondern aus Gottes Hand. Genau das ist die Alternative.
Eine der stärksten Szenen ist, als die Islamisten ins Kloster eindringen und den Bruder Arzt holen wollen, um ihre Verwundeten zu versorgen. Der Abt tritt ihm entgegen und setzt ihm auseinander, dass das nicht möglich ist. Er spricht die Sprache des Bandenführers, und er argumentiert mit dem Koran, den er auswendig zitierten kann. So lässt sich der, an dessen Händen Blut Unschuldiger klebt, überzeugen. Dieser feste Blick, diese Klarheit, diese Entschiedenheit und Klugheit: das stammt aus einem geistlichen Leben, aus dem Ringen mit großen Fragen, getragen von einer großen Liebe. Das kann man nicht abtun mit einer beiläufigen Klassifizierung von Märtyrern. Das besteht in jeder Welt.
weichensteller - 27. Jan, 00:07