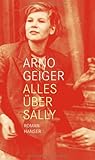2. haushofer, die wand, roman
Hugo und Luise werden als etwas eigenwilliges Paar beschrieben, mit ihren jeweiligen Marotten, aber durchaus freundlich: "Wie es so geht, im Umgang mit Hypochondern, hatten wir seine Zustände nicht mehr ernst genommen", beschreibt die Verlassene ihre Sorge um den nicht aus dem Dorf zurückgekehrten Jagdhausbesitzer, und "Luise liebte den Umgang mit Holzknechten und Bauernburschen, und es kam ihr nie in den Sinn, daß die verschlagenen Gesellen heimlich über sie lachen könnten" sieht sie ihre Kusine kritisch: die aussichtslose Anbiederung, das Dazugehörenwollen, das Publikumbrauchen als ebenso verzeihliche Schwäche wie die Jagd des vermögenden Gatten, der das Anwesen seiner Stellung zu schulden meint, obwohl er ein schlechter Schütze ist und nichts trifft. Diese beiden Eigenschaften dürften die beiden das Leben gekostet haben, sie kehren nie mehr aus dem Dorf zurück.
Noch etwas zum Rückblick auf die beiden: Ist es schon ausreichend bedacht worden, in welch großem Ausmaß sich die Erzählerin den beiden verdankt? Gerade ihre Eigenarten sind es, die ihr das Überleben ermöglichen, der gut dressierte Jagdhund, das Jagdhaus im Bergwald, die Jagd selbst, und die vom überängstlichen Besitzer mit Sammlerleidenschaft überreich eingelagerten Vorräte, denn es wurde immer über Atomkriege geredet damals. Gute Erinnerung also, und die Frau hatte sich den beiden ja aus eigenen Stücken angeschlossen, hatte ihren Umgang gesucht, wenn auch nicht aus inniger Übereinstimmung, so doch in loser Verwandtschaft und freundlicher Distanz. Kaum gedacht wird der beiden fast schon erwachsenen Töchter, außer dass sie der Mutter schon ein Maß an Freiheit und Unabhängigkeit zugestünden, und gar nicht des früheren Mannes. Dafür tauchen manchmal Kindheitserfahrungen auf aus der Landwirtschaft, die nun zum Überleben wichtig werden.
Aber alle diese sind nicht die letzten Menschen, die von der Frau zurückgelassen werden: ganz unerwartet erscheint der letzte Mensch und bringt nur Verderben, und verdient nichts als eine Kugel, keine Fragen, kein Verständigungsversuch, keine Erklärung. Und dieser erst offenbart mir die ganze Sinnlage dieses Abschieds. Kunst, Kultur, Literatur, Gesellschaft, Staat, Sinn werden mit einem Wisch weggefegt und nicht vermißt. Die Menschen gehen nicht ab. Man kann, wenn auch mühsam, unter Aufbietung aller Kräfte und Fähigkeiten, allein existieren. Eigentlich gut so. Und die Frage nach dem Hereinbrechen des Verhängnisses wird gar nicht gestellt. Der Forschungsdrang nach der Wand hält sich in Grenzen. Keine Frage nach dem Verbleib der Menschen, kein Gedanke an Tote, an Leichen, an Todesursachen. Eine vage Vorstellung von einer Kriegswaffe als Ursache des Verhängnisses, der nicht nachgegangen wird und die auch nicht korrigiert wird, als sie offensichtlich nicht zutreffen kann. Der allerletzte Mensch läßt den vorletzten ungerührt liegen und interessiert sich nicht für das Verhängnis. Und niemals fragt er: warum ich, warum gerade ich. Da scheint ein stillschweigendes Einverständnis vorzuliegen. Gut so, ich bin ja da, und eine Weile kann ich überleben. Und die anderen, die Verschwundenen: etwas hat sie weggenommen, das nicht verstehbar ist, und damit kann man einverstanden sein. Man muß es nicht rechtfertigen, sie wurden nicht ermordet, sie scheinen etwas lästig gewesen zu sein, das frühere Zusammensein erscheint immer irgendwie verhalten und angestrengt, keine Erinnerung an Einverständnis und Glück: ob nicht dieser allein auf sich gestellte Überlebenskampf eine Erleichterung ist, gar ein erfüllter Wunsch – ganz auf die vertraute und berechenbare Natur verwiesen, Tiere als dankbare Partner, verstehbar, einschätzbar, und dass sie nicht sprechen/ keine Fragen stellen, muß kein Nachteil sein.
Also doch einverstanden mit dem Ende des Menschen – es scheint eine neue Dimension des Menschlichen zu eröffnen: Fürsorge für solche, die nicht zurückgeben können.
Was offen bleibt bei diesem geheimen Einverständnis: warum wird nicht nach diesem absurden Schicksal gefragt? Etwa aus Vorsicht, die eigenen Wünsche zu deklarieren?
Ein Menschenende als Erleichterung und Trotz wegen der Fremdheit.
Noch etwas zum Rückblick auf die beiden: Ist es schon ausreichend bedacht worden, in welch großem Ausmaß sich die Erzählerin den beiden verdankt? Gerade ihre Eigenarten sind es, die ihr das Überleben ermöglichen, der gut dressierte Jagdhund, das Jagdhaus im Bergwald, die Jagd selbst, und die vom überängstlichen Besitzer mit Sammlerleidenschaft überreich eingelagerten Vorräte, denn es wurde immer über Atomkriege geredet damals. Gute Erinnerung also, und die Frau hatte sich den beiden ja aus eigenen Stücken angeschlossen, hatte ihren Umgang gesucht, wenn auch nicht aus inniger Übereinstimmung, so doch in loser Verwandtschaft und freundlicher Distanz. Kaum gedacht wird der beiden fast schon erwachsenen Töchter, außer dass sie der Mutter schon ein Maß an Freiheit und Unabhängigkeit zugestünden, und gar nicht des früheren Mannes. Dafür tauchen manchmal Kindheitserfahrungen auf aus der Landwirtschaft, die nun zum Überleben wichtig werden.
Aber alle diese sind nicht die letzten Menschen, die von der Frau zurückgelassen werden: ganz unerwartet erscheint der letzte Mensch und bringt nur Verderben, und verdient nichts als eine Kugel, keine Fragen, kein Verständigungsversuch, keine Erklärung. Und dieser erst offenbart mir die ganze Sinnlage dieses Abschieds. Kunst, Kultur, Literatur, Gesellschaft, Staat, Sinn werden mit einem Wisch weggefegt und nicht vermißt. Die Menschen gehen nicht ab. Man kann, wenn auch mühsam, unter Aufbietung aller Kräfte und Fähigkeiten, allein existieren. Eigentlich gut so. Und die Frage nach dem Hereinbrechen des Verhängnisses wird gar nicht gestellt. Der Forschungsdrang nach der Wand hält sich in Grenzen. Keine Frage nach dem Verbleib der Menschen, kein Gedanke an Tote, an Leichen, an Todesursachen. Eine vage Vorstellung von einer Kriegswaffe als Ursache des Verhängnisses, der nicht nachgegangen wird und die auch nicht korrigiert wird, als sie offensichtlich nicht zutreffen kann. Der allerletzte Mensch läßt den vorletzten ungerührt liegen und interessiert sich nicht für das Verhängnis. Und niemals fragt er: warum ich, warum gerade ich. Da scheint ein stillschweigendes Einverständnis vorzuliegen. Gut so, ich bin ja da, und eine Weile kann ich überleben. Und die anderen, die Verschwundenen: etwas hat sie weggenommen, das nicht verstehbar ist, und damit kann man einverstanden sein. Man muß es nicht rechtfertigen, sie wurden nicht ermordet, sie scheinen etwas lästig gewesen zu sein, das frühere Zusammensein erscheint immer irgendwie verhalten und angestrengt, keine Erinnerung an Einverständnis und Glück: ob nicht dieser allein auf sich gestellte Überlebenskampf eine Erleichterung ist, gar ein erfüllter Wunsch – ganz auf die vertraute und berechenbare Natur verwiesen, Tiere als dankbare Partner, verstehbar, einschätzbar, und dass sie nicht sprechen/ keine Fragen stellen, muß kein Nachteil sein.
Also doch einverstanden mit dem Ende des Menschen – es scheint eine neue Dimension des Menschlichen zu eröffnen: Fürsorge für solche, die nicht zurückgeben können.
Was offen bleibt bei diesem geheimen Einverständnis: warum wird nicht nach diesem absurden Schicksal gefragt? Etwa aus Vorsicht, die eigenen Wünsche zu deklarieren?
Ein Menschenende als Erleichterung und Trotz wegen der Fremdheit.
weichensteller - 13. Apr, 22:32