5. blanchot, der letzte mensch, erzählung
Im Zeichen des Paradoxes, steht im Klappentext. Was das bedeuten soll. Und so pflügt sich der Leser durch die Seiten, tastet sich, tastet nach Erzählung, nach Tatsachen und Vorfällen, nach Handlung, nach Eindeutigem. Kaum eine Aussage, der nicht sogleich widersprochen wird, kaum ein Satz, der so stehen bleiben kann – wiewohl doch viele Sätze da sind, und große.
Nun gut, drei Personen, der Erzähler, eine Frau, mit der er in besondere Beziehungen trat, und einer, der Professor genannt wird. Und man kann es nur so sagen: er tritt in Erscheinung, nach und nach. Und auf welche Art:
“Ich habe mich davon überzeugt, ihn zuerst tot, dann sterbend gekannt zu haben.” Sein Erscheinen ist ein unaufhörlicher Vorbeigang, “Ich gehe an seinem Zimmer vorbei”, “sein Schritt hat mich nie getäuscht”, “kommt er noch? geht er schon?”; er ist ein “so entsetzlich wenig schuldiges Geschöpf”, “immer unfehlbar”, “Man mußte ihn in einen Fehler locken”, “Er hat mir Gefühl gegeben für die Ewigkeit, für ein Wesen, das keiner Rechtfertigung bedürfte. Ich stelle mir letztlich einen Gott vor” -
Also darf einmal angenommen werden, es handle sich hier um eine Christus-Manifestation. Das Erkennen Christi, von der Begegnung mit dem Auferstandenen zurück blickend, die nachösterliche Perspektive auf sein irdisches Leben. Der Vorbeigang Gottes an den bezeichneten Häusern der Israeliten in Ägypten, dann hinter Mose am Berg Sinai, und nun der immerwährende Vorbeigang des Auferstandenen, der nicht festzuhalten ist, und auch sein Vorbeigang in den Gleichnissen, die eine fremde Wahrheit sagen in vertrauten Worten: “Nackte Worte, denen ich wegen meines Nichtwissens ausgeliefert bin.” “Er hat sie in einem bestimmten Augenblick in mir, zweifellos auch in vielen anderen abgelegt, und dieses monströse Gedächtnis müssen wir gemeinsam tragen bis zu der Transformation, von der uns nur ein Ende befreien wird” - Oder soll bei dem Gedächtnis nicht viel eher an die Abendmahlsworte gedacht werden, an Christi Testament und Vermächtnis, wo doch erzählt wird, wie “er seine Mahlzeiten mit den anderen einnahm. Er schien nicht viel kränker, vielleicht bedrohter, aber auf eine Art, die ihn nicht selber betraf.”
Jedenfalls deutlich die lebensspendende Wirkung, die von ihm ausgeht: “Er schien in mir Wegmarken aufzurichten: Sätze”, und so “fühlten wir uns wie mit vermehrter Existenz ausgerüstet, um uns selber angereichert, angereichert um das, was wir sein konnten, ja stärker, gefährlicher, böser und ganz in der Nähe eines Traums exzessiver Macht.”
Wenn ich an Gleichnisse gedacht habe, dann wegen des sich still öffnenden geheimen Raumes, der im Laufe des Textes immer stärker hervortritt. “Ich hatte manchmal, während seiner Worte, einen schnellen Wechsel der Sprechebene bemerkt. Was er sagte, wechselte die Richtung, richtete sich nicht mehr an uns, sondern an ihn, an einen anderen als ihn, an einen anderen Raum”. Es könnte auch ein Gebet gewesen sein. Dann das Gefühl, dort unten “gebe es eine Öffnung auf eine andere Gegend hinaus”: “Der Raum war fliehend, schlau, erschrocken. Vielleicht hatte er kein Zentrum, darum desorientierte er mich durch Flucht, durch List, durch Versuchung. Er entzog sich,; er entzog sich unaufhörlich”. Und immer deutlicher tritt ein Zustand hervor: “Die Art von Trunkenheit” “kam von diesem „Wir“, das aus mir strömte”, ein “Gefühl unendlichen Glücks”, wie ein “Berg, der sich schwindelerregend hoch von Universum zu Universum erhebt. Nie ein Halt, keine Grenze, eine immer trunkenere und immer ruhigere Trunkenheit. ‚Wir’“
Wer dieser letzte Mensch ist? Es muß der sein, der das Menschsein insgesamt angenommen hat und ihm damit eine Richtung gibt, einen Sinn, eine Erfüllung. Und die Menschen damit in ungeahnter Weise freisetzt zu einem Glück der unaufhörlichen Bejahung. Und es hat die Einsamkeit des Menschen, die vielleicht immer stärker hervortritt in seiner Verlorenheit, eine Antwort bekommen in einem Wir, einer mythischen Gemeinschaft: darum nämlich ist er der letzte Mensch. Mehr ist nicht zu erwarten.
Nun gut, drei Personen, der Erzähler, eine Frau, mit der er in besondere Beziehungen trat, und einer, der Professor genannt wird. Und man kann es nur so sagen: er tritt in Erscheinung, nach und nach. Und auf welche Art:
“Ich habe mich davon überzeugt, ihn zuerst tot, dann sterbend gekannt zu haben.” Sein Erscheinen ist ein unaufhörlicher Vorbeigang, “Ich gehe an seinem Zimmer vorbei”, “sein Schritt hat mich nie getäuscht”, “kommt er noch? geht er schon?”; er ist ein “so entsetzlich wenig schuldiges Geschöpf”, “immer unfehlbar”, “Man mußte ihn in einen Fehler locken”, “Er hat mir Gefühl gegeben für die Ewigkeit, für ein Wesen, das keiner Rechtfertigung bedürfte. Ich stelle mir letztlich einen Gott vor” -
Also darf einmal angenommen werden, es handle sich hier um eine Christus-Manifestation. Das Erkennen Christi, von der Begegnung mit dem Auferstandenen zurück blickend, die nachösterliche Perspektive auf sein irdisches Leben. Der Vorbeigang Gottes an den bezeichneten Häusern der Israeliten in Ägypten, dann hinter Mose am Berg Sinai, und nun der immerwährende Vorbeigang des Auferstandenen, der nicht festzuhalten ist, und auch sein Vorbeigang in den Gleichnissen, die eine fremde Wahrheit sagen in vertrauten Worten: “Nackte Worte, denen ich wegen meines Nichtwissens ausgeliefert bin.” “Er hat sie in einem bestimmten Augenblick in mir, zweifellos auch in vielen anderen abgelegt, und dieses monströse Gedächtnis müssen wir gemeinsam tragen bis zu der Transformation, von der uns nur ein Ende befreien wird” - Oder soll bei dem Gedächtnis nicht viel eher an die Abendmahlsworte gedacht werden, an Christi Testament und Vermächtnis, wo doch erzählt wird, wie “er seine Mahlzeiten mit den anderen einnahm. Er schien nicht viel kränker, vielleicht bedrohter, aber auf eine Art, die ihn nicht selber betraf.”
Jedenfalls deutlich die lebensspendende Wirkung, die von ihm ausgeht: “Er schien in mir Wegmarken aufzurichten: Sätze”, und so “fühlten wir uns wie mit vermehrter Existenz ausgerüstet, um uns selber angereichert, angereichert um das, was wir sein konnten, ja stärker, gefährlicher, böser und ganz in der Nähe eines Traums exzessiver Macht.”
Wenn ich an Gleichnisse gedacht habe, dann wegen des sich still öffnenden geheimen Raumes, der im Laufe des Textes immer stärker hervortritt. “Ich hatte manchmal, während seiner Worte, einen schnellen Wechsel der Sprechebene bemerkt. Was er sagte, wechselte die Richtung, richtete sich nicht mehr an uns, sondern an ihn, an einen anderen als ihn, an einen anderen Raum”. Es könnte auch ein Gebet gewesen sein. Dann das Gefühl, dort unten “gebe es eine Öffnung auf eine andere Gegend hinaus”: “Der Raum war fliehend, schlau, erschrocken. Vielleicht hatte er kein Zentrum, darum desorientierte er mich durch Flucht, durch List, durch Versuchung. Er entzog sich,; er entzog sich unaufhörlich”. Und immer deutlicher tritt ein Zustand hervor: “Die Art von Trunkenheit” “kam von diesem „Wir“, das aus mir strömte”, ein “Gefühl unendlichen Glücks”, wie ein “Berg, der sich schwindelerregend hoch von Universum zu Universum erhebt. Nie ein Halt, keine Grenze, eine immer trunkenere und immer ruhigere Trunkenheit. ‚Wir’“
Wer dieser letzte Mensch ist? Es muß der sein, der das Menschsein insgesamt angenommen hat und ihm damit eine Richtung gibt, einen Sinn, eine Erfüllung. Und die Menschen damit in ungeahnter Weise freisetzt zu einem Glück der unaufhörlichen Bejahung. Und es hat die Einsamkeit des Menschen, die vielleicht immer stärker hervortritt in seiner Verlorenheit, eine Antwort bekommen in einem Wir, einer mythischen Gemeinschaft: darum nämlich ist er der letzte Mensch. Mehr ist nicht zu erwarten.
weichensteller - 13. Apr, 22:27





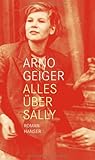












in der nähe
Wie aber beginnt er lebendig zu werden, wenn man die Gottesknecht-Texte des Jesaja hinzuhält! - und noch mehr, wenn sie in der lukanischen Interpretation auf Christus hin gelesen werden!
Und deshalb muss man, so lohnend auch die minutiöse Anlegung der Bibelbezüge wäre, auch andere moderne Texte dazustellen. Ich möchte an einige Erzählungen Robert Musils erinnern, der nämlich nahezu dasselbe Verfahren anwendet, den erläuternden und weiterführenden Bibelkommentar in eine heutige Beziehungsgeschichte einzuwickeln, die für sich selbst genommen schon eine eigene Aussage enthält: Wen liebst du, zu wem gehörst du, in der Dreierbeziehung zweier Männer und einer Frau gefragt:
Vereinigungen: Die Vollendung der Liebe. / Die Versuchung der stillen Veronika.
Aber auch die Novellen: Drei Frauen. Grigia/ Die Portugiesin/ Tonka sind, wenn auch mehr erzählerisch, als Verwandte zu betrachten.
Die Präsenz der "Veronika", dieser "religiösen Kunstfigur", die, Jesus am Kreuzweg begleitend, im Schweißtuch sein WAHRES ABBILD, die vera eikona erhält: eine Spur des Menschgewordenen - diese Präsenz steht selber für das Bezeichnete/ für den Bezeichneten.