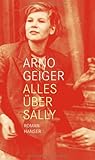PARADIES: Hoffnung
Der dritte Teil der verschränkten Trilogie zeigt, was die Tochter macht, während die Mutter ihr Glück in Kenia sucht und die Tante mit der Marienstatue von Wohnung zu Wohnung zieht. Sie kommt in ein Diätcamp und soll dort mit Disziplin und Gymnastik ihre Fettleibigkeit in den Griff bekommen. Schließlich lassen sich alle drei auf Abenteuer ein, und Melanie wird darin genauso herausgefordert wie die anderen beiden Frauen. Ein ästhetisches Spiel sind die Prozessionen, die Choreographien der ausgesetzten Kinder. Stumm stapfen sie im Gänsemarsch durch Turnsaal und Waldlandschaft. Stumm auch die Erwachsenen, abgesehen von den Drill-Kommandos. Ihre menschliche Kälte lässt die Bilder gefrieren, kein freundliches Wort, kein Mitgefühl, kein Beziehungsangebot. Das ist das eigentliche Unglück, und das sonderbar inkonsequente Verhalten des Arztes (es müsste gesagt werden: das sträflich unprofessionelle Verhalten!) ist davon nur der Teil, der für Melanie bedeutsam wird: weil sie sich in ihn verliebt.
In Seidls Werk wird dem Betrachter viel zugemutet. Er/Sie muss Menschen, Gespräche und Situationen ertragen können. Sich an Afrikanern sexuell bedienende Europäerinnen. Sich in wildfremde Hausfluren wagende Glaubenskämpferin. Und nun ein Kinderarzt, der eine Dreizehnjährige neugierig macht auf sich, sie mit Tastspielen verwirrt, und erst dann und spät, wenn sie um ihn wirbt, Position bezieht. Durch Ablehnung. Beklemmend seine stumme Verfolgung des Mädchens durch den Wald – die Umarmung weder leidenschaftlich noch väterlich, eher hilflos und jedenfalls stumm. Da sind sie sich ebenbürtig. Beklemmend ebenso die stumme Annäherung des Burschen an die Betrunkene in der Diskothek, sein beharrliches Hantieren am Leib der Bewusstlosen. Das war es doch gerade, wovor sie entrinnen wollte! In den Gesprächen mit den Mädchen, im Werben um den Arzt! Das Unerträgliche bei Seidl ist die Sprachlosigkeit. Die Unfähigkeit zu verstehen. Auch sich selbst. Die daraus resultierende Unbarmherzigkeit. Sehnlichst wünscht sich der Zuschauer ein Einlenken, ein Beidrehen, Mitleid und Mitgefühl. Das können im Film nur die Kinder einander geben, auf ihre Art. Leidensgenossen. Was weiterhin fehlt, ist Väterlichkeit, Mütterlichkeit, Partnerschaftlichkeit.
Was es aber gibt: Ertragen. Das ist etwas Pastorales in diesen Filmen. Solche Menschen aushalten. Solche Situationen. Dennoch bleibt die Frage nach dem Paradiesischen. Es kommt überall nur im Modus der Erwartung vor, nie in der Realität. Selbst die winzigsten Anzeichen werden unverzüglich als trügerisch entlarvt. Aber hinter solchen Anzeichen sind die Menschen her. Doch Liebe, Glauben und Hoffnung sind nie ohne Ambivalenz. Im Korintherbrief klingt es, als wären diese menschlichen Erfahrungen sichere und eindeutige Zeichen des Himmels auf Erden. Aber sie sind es nicht. Hier ist alles unvollkommen. Alles. Das Paradies ist das Durchhalten.
In Seidls Werk wird dem Betrachter viel zugemutet. Er/Sie muss Menschen, Gespräche und Situationen ertragen können. Sich an Afrikanern sexuell bedienende Europäerinnen. Sich in wildfremde Hausfluren wagende Glaubenskämpferin. Und nun ein Kinderarzt, der eine Dreizehnjährige neugierig macht auf sich, sie mit Tastspielen verwirrt, und erst dann und spät, wenn sie um ihn wirbt, Position bezieht. Durch Ablehnung. Beklemmend seine stumme Verfolgung des Mädchens durch den Wald – die Umarmung weder leidenschaftlich noch väterlich, eher hilflos und jedenfalls stumm. Da sind sie sich ebenbürtig. Beklemmend ebenso die stumme Annäherung des Burschen an die Betrunkene in der Diskothek, sein beharrliches Hantieren am Leib der Bewusstlosen. Das war es doch gerade, wovor sie entrinnen wollte! In den Gesprächen mit den Mädchen, im Werben um den Arzt! Das Unerträgliche bei Seidl ist die Sprachlosigkeit. Die Unfähigkeit zu verstehen. Auch sich selbst. Die daraus resultierende Unbarmherzigkeit. Sehnlichst wünscht sich der Zuschauer ein Einlenken, ein Beidrehen, Mitleid und Mitgefühl. Das können im Film nur die Kinder einander geben, auf ihre Art. Leidensgenossen. Was weiterhin fehlt, ist Väterlichkeit, Mütterlichkeit, Partnerschaftlichkeit.
Was es aber gibt: Ertragen. Das ist etwas Pastorales in diesen Filmen. Solche Menschen aushalten. Solche Situationen. Dennoch bleibt die Frage nach dem Paradiesischen. Es kommt überall nur im Modus der Erwartung vor, nie in der Realität. Selbst die winzigsten Anzeichen werden unverzüglich als trügerisch entlarvt. Aber hinter solchen Anzeichen sind die Menschen her. Doch Liebe, Glauben und Hoffnung sind nie ohne Ambivalenz. Im Korintherbrief klingt es, als wären diese menschlichen Erfahrungen sichere und eindeutige Zeichen des Himmels auf Erden. Aber sie sind es nicht. Hier ist alles unvollkommen. Alles. Das Paradies ist das Durchhalten.
weichensteller - 11. Apr, 23:48