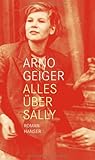„Er hat nichts, wofür er lebt. es lebt um ihn herum“, beschreibt Tobias Moretti den von ihm dargestellten Polizisten Thomas Dorn: „ein prototypischer, heutiger, überforderter Mensch, der in einem Vakuum lebt“, zu sehen in „Das Jüngste Gericht“, Regie Urs Egger. Die Kommissare werden auch immer menschlicher, keine Weisen mehr, unbestechlich, schlau, sondern behaftet mit privaten Problemen wie du und ich.
Aus den Bergen des hohen Geistes kam einst Zarathustra in die Stadt herunter, um die Menschen den Übergang zu lehren, und bei ihrem Stolz spricht er sie an:
So will ich ihnen vom Verächtlichsten sprechen: das aber ist d e r l e t z t e M e n s c h. .... Seht! Ich zeige euch d e n l e t z t e n M e n s c h e n. „Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?“ – so fragt der letzte Mensch und blinzelt.
Dieser letzte Mensch begegnet in seiner Überforderung. Er lebt einigermaßen bequem und hat keine großen Ziele, nichts, was ihn wahrhaft herausfordern würde, nichts, wofür zu kämpfen sich lohnt. Immerhin, ein Kommissar erhebt sich aus der Gleichmäßigkeit, beginnt zu forschen und zu fragen: aber wird dieser letzte Mensch vor den
großen Herausforderungen bestehen können? Das Jüngste Gericht, die letzte, größte, umfassendste Infragestellung des Menschen, seiner Taten und Ziele. Aber Zarathustra sieht den letzten Menschen blinzeln: er lacht ihn aus, er nimmt ihn nicht ernst, er verweigert die Begegnung. Der letzte Mensch ist der verachtete und verächtliche Mensch.
Siehe/Höre:
https://www.youtube.com/watch?v=dbI5K0AzNHIweichensteller - 13. Apr, 22:33
Hugo und Luise werden als etwas eigenwilliges Paar beschrieben, mit ihren jeweiligen Marotten, aber durchaus freundlich: "Wie es so geht, im Umgang mit Hypochondern, hatten wir seine Zustände nicht mehr ernst genommen", beschreibt die Verlassene ihre Sorge um den nicht aus dem Dorf zurückgekehrten Jagdhausbesitzer, und "Luise liebte den Umgang mit Holzknechten und Bauernburschen, und es kam ihr nie in den Sinn, daß die verschlagenen Gesellen heimlich über sie lachen könnten" sieht sie ihre Kusine kritisch: die aussichtslose Anbiederung, das Dazugehörenwollen, das Publikumbrauchen als ebenso verzeihliche Schwäche wie die Jagd des vermögenden Gatten, der das Anwesen seiner Stellung zu schulden meint, obwohl er ein schlechter Schütze ist und nichts trifft. Diese beiden Eigenschaften dürften die beiden das Leben gekostet haben, sie kehren nie mehr aus dem Dorf zurück.
Noch etwas zum Rückblick auf die beiden: Ist es schon ausreichend bedacht worden, in welch großem Ausmaß sich die Erzählerin den beiden verdankt? Gerade ihre Eigenarten sind es, die ihr das Überleben ermöglichen, der gut dressierte Jagdhund, das Jagdhaus im Bergwald, die Jagd selbst, und die vom überängstlichen Besitzer mit Sammlerleidenschaft überreich eingelagerten Vorräte, denn es wurde immer über Atomkriege geredet damals. Gute Erinnerung also, und die Frau hatte sich den beiden ja aus eigenen Stücken angeschlossen, hatte ihren Umgang gesucht, wenn auch nicht aus inniger Übereinstimmung, so doch in loser Verwandtschaft und freundlicher Distanz. Kaum gedacht wird der beiden fast schon erwachsenen Töchter, außer dass sie der Mutter schon ein Maß an Freiheit und Unabhängigkeit zugestünden, und gar nicht des früheren Mannes. Dafür tauchen manchmal Kindheitserfahrungen auf aus der Landwirtschaft, die nun zum Überleben wichtig werden.
Aber alle diese sind nicht die letzten Menschen, die von der Frau zurückgelassen werden: ganz unerwartet erscheint der letzte Mensch und bringt nur Verderben, und verdient nichts als eine Kugel, keine Fragen, kein Verständigungsversuch, keine Erklärung. Und dieser erst offenbart mir die ganze Sinnlage dieses Abschieds. Kunst, Kultur, Literatur, Gesellschaft, Staat, Sinn werden mit einem Wisch weggefegt und nicht vermißt. Die Menschen gehen nicht ab. Man kann, wenn auch mühsam, unter Aufbietung aller Kräfte und Fähigkeiten, allein existieren. Eigentlich gut so. Und die Frage nach dem Hereinbrechen des Verhängnisses wird gar nicht gestellt. Der Forschungsdrang nach der Wand hält sich in Grenzen. Keine Frage nach dem Verbleib der Menschen, kein Gedanke an Tote, an Leichen, an Todesursachen. Eine vage Vorstellung von einer Kriegswaffe als Ursache des Verhängnisses, der nicht nachgegangen wird und die auch nicht korrigiert wird, als sie offensichtlich nicht zutreffen kann. Der allerletzte Mensch läßt den vorletzten ungerührt liegen und interessiert sich nicht für das Verhängnis. Und niemals fragt er: warum ich, warum gerade ich. Da scheint ein stillschweigendes Einverständnis vorzuliegen. Gut so, ich bin ja da, und eine Weile kann ich überleben. Und die anderen, die Verschwundenen: etwas hat sie weggenommen, das nicht verstehbar ist, und damit kann man einverstanden sein. Man muß es nicht rechtfertigen, sie wurden nicht ermordet, sie scheinen etwas lästig gewesen zu sein, das frühere Zusammensein erscheint immer irgendwie verhalten und angestrengt, keine Erinnerung an Einverständnis und Glück: ob nicht dieser allein auf sich gestellte Überlebenskampf eine Erleichterung ist, gar ein erfüllter Wunsch – ganz auf die vertraute und berechenbare Natur verwiesen, Tiere als dankbare Partner, verstehbar, einschätzbar, und dass sie nicht sprechen/ keine Fragen stellen, muß kein Nachteil sein.
Also doch einverstanden mit dem Ende des Menschen – es scheint eine neue Dimension des Menschlichen zu eröffnen: Fürsorge für solche, die nicht zurückgeben können.
Was offen bleibt bei diesem geheimen Einverständnis: warum wird nicht nach diesem absurden Schicksal gefragt? Etwa aus Vorsicht, die eigenen Wünsche zu deklarieren?
Ein Menschenende als Erleichterung und Trotz wegen der Fremdheit.
weichensteller - 13. Apr, 22:32
Noch harmloser beginnt das Menschenende für Jonas. Ein Montag Morgen, Frühstück, der Weg zur Arbeit. Doch auch ihm gehen nicht sogleich die Menschen ab, zuerst kein Radio, kein Internet, kein Fernsehen, keine Zeitung, keine Telefonverbindung. Aber bald werden Menschen gesucht: Marie, der Vater, die Arbeitskollegen. Stattdessen leere Straßen in Wien, keine Passanten, kein Verkehr, nichts regt sich, sogar die Vögel scheinen anfangs verstummt. Auch Jonas fragt und forscht nicht nach den Ursachen – aber er nimmt das Fehlen der Menschheit nicht sogleich als gegeben hin. Zwei Impulse treiben ihn durch die entleerte Welt seit diesem Tag: Kontakt aufzunehmen mit Überlebenden, und sich seiner selbst zu vergewissern. Der Überlebenskampf fällt ihm leicht: die verschwundenen Menschen haben Autos und Lebensmittel hinterlassen, und die Stromversorgung scheint irgendwie von selbst zu laufen im Lande der Wasserkraft (die Atomkraftwerke in England erscheinen glücklicherweise nicht im Fokus der Geschichte). Aber Jonas ist auf all seinen Vergewisserungsreisen ständig beschäftigt, Zettel mit Nachrichten und seiner Telefonnummer zu hinterlassen. Und er bildet eine seltsame Marotte aus, überall Videogeräte zu postieren, die ihn selbst aufnehmen, und unter Aufwand aller Kräfte sieht er sich immer wieder die Bänder an, auf denen er selbst durch die nun leere Welt irrt: Selbstvergewisserung ohne Du.
Immerhin: Jonas sucht nach Menschen, nach dem Vater und seinen Spuren, nach Marie, seiner Freundin, die im Ausland war, und nach sich selbst. Mysteriöse Zeichen einer geheimen Anwesenheit entdeckt er, in der Wand eingemauert, unbewußte Regungen im Schlaf , ohne Kontrolle, aber gefilmt.
Die Begegnungen mit der Natur sind krisenhaft, das Wetter, die Orientierung im Wald, das Zeitgefühl sind unverläßlich und unerprobt. Jonas fühlt sich der Natur nicht gewachsen, hier ist er fremd. Nah sind ihm seine Erinnerungen, die vertrauten Orte mit Spuren von Gemeinsamkeit oder von sich selbst. Jonas hilft sich mit Technik, mit Autos und Supermärkten. Und in einem fort schreit er ins leere All hinaus: ich bin da, ich bin da!
Wie vor der Wand gibt es kein Fragen, kein Nachfragen. Kann man fragen nur mit einem Gegenüber? Gibt es keine Sinnsuche eines Einzelnen? Nimmt der Mensch seine Einsamkeit als gegeben, ohne zu rebellieren?
Aber es gibt ein Suchen, einen verzweifelten Kampf, wieder besseres Wissen doch noch zu entrinnen einem unerbittlichen, unverstandenen Schicksal, und sich zu retten zu dem einzigen Menschen, zu Marie, und das gar nicht wegen der besonders guten und verständnisvollen Beziehung, sondern eher als Wiedergutmachungsversuch.
Zuletzt das Fallen, nun wie ein Einverständnis mit einem unbegreiflichen Verhängnis, das Fallen aus der Zeit, deren Dimensionen von Menschenleben und Zeitaltern, von Geschichte und Halbwertszeiten des radioaktiven Mülls, und somit auch ein Fallen aus der Verantwortung, die dem Menschen zu groß geworden war, als dass er sie noch tragen hätte können, und somit etwas wie ein Zurückfallen zu dem, wo es eigentlich hingehört nach seiner Bestimmung, nach einer ungerechtfertigten Selbstermächtigung.
Also wiederum ein Einverständnis mit dem Verschwinden des Menschen.
weichensteller - 13. Apr, 22:31
Wenn über den großen Städten der Erde stumm Raumschiffe erscheinen, so mag das heutigen Cineasten bekannt vorkommen. Wenn von ihnen aber nicht Vernichtung ausgeht, sondern vorsichtige und höfliche Mahnungen und Weisungen, was das Geschick der Menschheit betrifft, in akzentfreiem Englisch, so mag der Leser an einen Bluff denken. Wenn aber dann Krieg und Hunger, Not und Ungerechtigkeit nach und nach verschwinden, sich die Overlords aber erst nach 50 Jahren zeigen wollen, so liegt der Geschichte doch ein großer außerirdischer Plan zugrunde. Zwar muß zugegeben werden: die Overlords ersetzen bald jede Religion durch moderne Wissenschaft und Technik. Aber die Bereitschaft der Menschen zu Unterwerfung nehmen diese Fremden, die nun das Geschick der Erde lenken, gerne an. Und die penetrante Zurückhaltung der Erscheinung der Fremden scheint weniger auf die fehlende Reife der Menschen, als auf ihre Lächerlichkeit zurückzuführen sein: wie große, den Menschen weit überragende apokalyptische Engel mit Flügel, die aus der Nähe säuerlich riechen und das Sonnenlicht nicht gut vertragen.
Zwei bescheidene Rebellionen der Menschen gibt es, welche die Overlords zwar überraschen, aber dann mit Nachsicht quittiert werden: der Raumfahrer, der sich in eines ihrer Versorgungsschiffe einschleust und so auf ihren Heimatplaneten kommt (ein insgesamt in seiner Beiläufigkeit enttäuschendes Erlebnis), und die Inselkolonie, die sich selbst steuern und verwalten will, ein letztes Aufbäumen von Selbständigkeit und eigener Vernunft. Und gerade diese wird auf ungeahnte Weise frei gesetzt und offenbart zuletzt nun doch ein Jenseits, eine Dimension, auf welche die Overlords keinen Zugriff haben und vor der sie sich bescheiden. Die Offenbarung dieses Neuen wird zwar mit der Sprache der Science Fiction ertastet, aber es ist ein Gestammel. Die fremde, überlegene Intelligenz zieht sich zurück, aber der Mensch – freilich ein neuer, transformierter Mensch – ist der Eintrittsort dieses Neuen: im Menschen inkarniert es, während die Sterne vom Himmel fallen und die letzte Generation verschwunden ist in blasser Zeugenschaft. Eine wahrhaft apokalyptische Vision in der gesamten Bilderfülle des letzten Buchs der Bibel. Und nun doch ein ungenanntes Jenseits und ein Zusichkommen der gesamten Schöpfung.
Eine Erlösung? Fragt sich, für wen.
weichensteller - 13. Apr, 22:30
Im Zeichen des Paradoxes, steht im Klappentext. Was das bedeuten soll. Und so pflügt sich der Leser durch die Seiten, tastet sich, tastet nach Erzählung, nach Tatsachen und Vorfällen, nach Handlung, nach Eindeutigem. Kaum eine Aussage, der nicht sogleich widersprochen wird, kaum ein Satz, der so stehen bleiben kann – wiewohl doch viele Sätze da sind, und große.
Nun gut, drei Personen, der Erzähler, eine Frau, mit der er in besondere Beziehungen trat, und einer, der Professor genannt wird. Und man kann es nur so sagen: er tritt in Erscheinung, nach und nach. Und auf welche Art:
“Ich habe mich davon überzeugt, ihn zuerst tot, dann sterbend gekannt zu haben.” Sein Erscheinen ist ein unaufhörlicher Vorbeigang, “Ich gehe an seinem Zimmer vorbei”, “sein Schritt hat mich nie getäuscht”, “kommt er noch? geht er schon?”; er ist ein “so entsetzlich wenig schuldiges Geschöpf”, “immer unfehlbar”, “Man mußte ihn in einen Fehler locken”, “Er hat mir Gefühl gegeben für die Ewigkeit, für ein Wesen, das keiner Rechtfertigung bedürfte. Ich stelle mir letztlich einen Gott vor” -
Also darf einmal angenommen werden, es handle sich hier um eine Christus-Manifestation. Das Erkennen Christi, von der Begegnung mit dem Auferstandenen zurück blickend, die nachösterliche Perspektive auf sein irdisches Leben. Der Vorbeigang Gottes an den bezeichneten Häusern der Israeliten in Ägypten, dann hinter Mose am Berg Sinai, und nun der immerwährende Vorbeigang des Auferstandenen, der nicht festzuhalten ist, und auch sein Vorbeigang in den Gleichnissen, die eine fremde Wahrheit sagen in vertrauten Worten: “Nackte Worte, denen ich wegen meines Nichtwissens ausgeliefert bin.” “Er hat sie in einem bestimmten Augenblick in mir, zweifellos auch in vielen anderen abgelegt, und dieses monströse Gedächtnis müssen wir gemeinsam tragen bis zu der Transformation, von der uns nur ein Ende befreien wird” - Oder soll bei dem Gedächtnis nicht viel eher an die Abendmahlsworte gedacht werden, an Christi Testament und Vermächtnis, wo doch erzählt wird, wie “er seine Mahlzeiten mit den anderen einnahm. Er schien nicht viel kränker, vielleicht bedrohter, aber auf eine Art, die ihn nicht selber betraf.”
Jedenfalls deutlich die lebensspendende Wirkung, die von ihm ausgeht: “Er schien in mir Wegmarken aufzurichten: Sätze”, und so “fühlten wir uns wie mit vermehrter Existenz ausgerüstet, um uns selber angereichert, angereichert um das, was wir sein konnten, ja stärker, gefährlicher, böser und ganz in der Nähe eines Traums exzessiver Macht.”
Wenn ich an Gleichnisse gedacht habe, dann wegen des sich still öffnenden geheimen Raumes, der im Laufe des Textes immer stärker hervortritt. “Ich hatte manchmal, während seiner Worte, einen schnellen Wechsel der Sprechebene bemerkt. Was er sagte, wechselte die Richtung, richtete sich nicht mehr an uns, sondern an ihn, an einen anderen als ihn, an einen anderen Raum”. Es könnte auch ein Gebet gewesen sein. Dann das Gefühl, dort unten “gebe es eine Öffnung auf eine andere Gegend hinaus”: “Der Raum war fliehend, schlau, erschrocken. Vielleicht hatte er kein Zentrum, darum desorientierte er mich durch Flucht, durch List, durch Versuchung. Er entzog sich,; er entzog sich unaufhörlich”. Und immer deutlicher tritt ein Zustand hervor: “Die Art von Trunkenheit” “kam von diesem „Wir“, das aus mir strömte”, ein “Gefühl unendlichen Glücks”, wie ein “Berg, der sich schwindelerregend hoch von Universum zu Universum erhebt. Nie ein Halt, keine Grenze, eine immer trunkenere und immer ruhigere Trunkenheit. ‚Wir’“
Wer dieser letzte Mensch ist? Es muß der sein, der das Menschsein insgesamt angenommen hat und ihm damit eine Richtung gibt, einen Sinn, eine Erfüllung. Und die Menschen damit in ungeahnter Weise freisetzt zu einem Glück der unaufhörlichen Bejahung. Und es hat die Einsamkeit des Menschen, die vielleicht immer stärker hervortritt in seiner Verlorenheit, eine Antwort bekommen in einem Wir, einer mythischen Gemeinschaft: darum nämlich ist er der letzte Mensch. Mehr ist nicht zu erwarten.
weichensteller - 13. Apr, 22:27